„Die Rolle des Bischofs von Rom in der Gemeinschaft der Kirchen des 1. Jahrtausend“
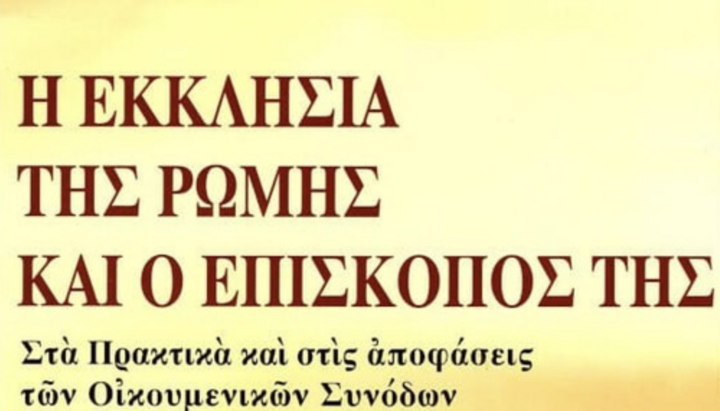
Zum Anlass des Todes von Papst Franziszkus.
Übersetzung eines Artikels der UOJ in Griechenland
Anlässlich des Todes von Papst Franzikus veröffentlichen wir diesen selbigen Artikel, der ein Ausschnitt aus der Diplomarbeit (Magister bzw. Master) von Vater Anastasios Gotsopoulos mit dem Titel Die Kirche von Rom und ihr Bischof in den Protokollen und Beschlüssen der Ökumenischen Konzile ist.
„Aus der Untersuchung der Protokollen und der Beschlüsse der Ökumenischen Konzile können wir mit Sicherheit die Position der römischen Kirche und der Bischöfe der Gemeinschaft der Ortskirchen während der Epoche der Ökumenischen Konzile feststellen.
A. Die Kirche und der Bischof von Rom.
- Das gestiegene Ansehen und die außergewöhnliche Ehre, die der Kirche von Rom zuteil wurden, ist offensichtlich. Folglich hatte die Kirche jenen Bischof den Ehrenprimat und den Vorrang in der Reihenfolge derjenigen zuerkannt, die mit dem Vorrecht des Ältesten der patriarchalischen Throne geehrt wurden. Die Gründe sind klar: a) sie war die Kirche des „großen Roms“, der Hauptstadt des Reiches, b) sie war aktiv im geistlichen Leben und in den gemeinsamen Auffassungen sonstiger Angelegenheiten in den Ortskirchen und c) sie war die einzige Stadt in der westlich-lateinischen Welt, die die Anwesenheit und Predigt der ersten Apostel, die dort den Märtyrertod erlitten, anerkannte und ihre Gräber bewahrte.
- Die Kirche von Rom war besonders stolz auf ihre apostolische Abstammung von den höchstrangigen unter ihnen, die sie als Produkt der Zeit bezeichneten und in einen „Stein“ umwandelten. Es ist jedoch anzumerken, dass in keinem Kanon eines Ökumenischen Konzils die Zuerkennung von Vorrechten an die Kirche von Rom, die an deren apostolischen Ursprung geknüpft sind, erwähnt wird, was sonst als selbstverständlich gilt.
- Im Osten wurde der Begriff der Apostolizität anders interpretiert und daher bekam diese auch eine andere Bedeutung. Gleichzeitig akzeptierte jedoch die gesamte Kirche, dass die Apostolizität kein ausschließliches Privileg Roms war, sondern auch für diejenigen galt, die im Osten auf Thronen mit außergewöhnlichen Privilegien geehrt wurden.
- Die alte Kirche — im Osten wie im Westen — hatte den Ehrenprimat und den Vorrang des Bischofs von Rom anerkannt: nicht aber den Autoritätsprimat (die höchste Gerichtsbarkeit) über die gesamte Kirche. Der gelegentliche Versuch römischer Legaten, den Privilegien eine Dimension des Autoritätsprimats zu verleihen, betraf nicht alle Bischöfe Roms, selbst wenn sie „petrischen“ Ursprungs waren, und war selbstverständlich nicht die bewährte und stetige Stellungnahme der gesamten westlich-lateinischen Kirche des Zeitalters der Ökumenischen Konzile.
- Wenn eine wichtige Frage des Glaubens und der kirchlichen Ordnung aufkam, hatte jeder Bischof, insbesondere der des „großen Roms“, nicht nur das unveräußerliche Recht, sondern auch die zwingende Pflicht, auch in einer anderen Ortskirche einzugreifen. Diese Praxis war während der ersten acht Jahrhunderte des Christentums völlig in Ordnung. Tatsächlich bestand die kirchliche Einheit in Ausnahmefällen nicht unbedingt in der Gemeinschaft mit demjenigen, der den Vorrang hatte oder auf dem Ehrenthron saß, sondern mit demjenigen, der im konkreten Fall den wahren Glauben zum Ausdruck brachte und über den „Ursprung der Wahrheit“ verfügte. Dies geschah durch den Heiligen Geist. Beispielsweise Kyrill III. Oder Papst Leo XVI. beim Vierten Ökumenischen Konzil. Andererseits wurde die Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, als er sich seines bischöflichen Amtes als unwürdig erwies, nicht nur im Osten, sondern auch in den Ortskirchen des Westens abgebrochen.
B. Der Bischof von Rom und die Ökumenischen Konzile
- Die ökumenischen Konzile waren für die alte Kirche die Höhepunkte der Verkörperung ihrer Einheit in der Wahrheit. Gleichzeitig machte die alte Kirche absolut klar, dass das Oberhaupt und die höchste Autorität in der Kirche nicht eine einzige Person sein kann, sondern das Ökumenische Konzil, dessen Beschlüsse jeder zu beachten hat.
- Die Verantwortung für die Einberufung der Ökumenischen Konzile lag ausschließlich beim Kaiser, der auch die entsprechenden Verfahren festlegte. Sicherlich war eine Absprache mit den Bischöfen der vorrangigen („erstthrönigen“) Kirchen und insbesondere mit denen von Rom und Konstantinopel unerlässlich. Der Vorrang des Bischofs von Rom verlieh ihm allerdings weder das Recht, über Verfahrensfragen der Konzile zu entscheiden, noch ein Vetorecht.
- Der Papst selbst nahm an keinem Ökumenischen Konzil persönlich teil, war aber stets dort vertreten. Außerdem hatten seine Stellvertreter bei keinem Konzil den Vorsitz. Von besonderer Bedeutung für die Rolle des Papstes von Rom in der Gemeinschaft der Ortskirchen ist das Fünfte Ökumenische Konzil, das neben der theologischen Frage der Drei Kapitel auch über diese Frage entschied und Papst Vigilius verurteilte, nachdem dieser sich ungerechtfertigt geweigert hatte, sich mit den anderen Patriarchen zu treffen. Für die alte Kirche — im Osten wie im Westen — ist der Papst nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch in Fragen der kanonischen Ordnung dem richterlichen Urteil und der Autorität des Konzils unterworfen.
- Die Hauptaufgabe des Bischofs von Rom in den Ökumenischen Konzilen als erster unter den Patriarchen bestand darin, in seinem dogmatischen Schreiben, das gewissermaßen als zentrale Einführung in das Konzil diente, den orthodoxen Glauben und die kirchliche Tradition zu den aufkommenden theologischen Fragen zu formulieren, auf dessen Grundlage die synodalen Diskussionen geführt wurden. Folglich war des Papstes Platz während der Epoche der Ökumenischen Konzilen in den Konzilen und nicht über sie. Nur unter der Bedingung der Teilnahme an den Konzilsverhandlungen wurde der Papst als „Haupt und Vater und Erster“ der mit ihm teilnehmenden Bischöfe und Patriarchen anerkannt: Er entschied nicht, worauf die anderen gehorchten, sondern „er beriet sich … mit allen“.
C. Der Bischof von Rom in den Beschlüssen der Ökumenischen Konzilen.
- Die Kirche versuchte, durch die Ökumenischen Konzile dem Verderben des orthodoxen Glaubens und der Zerstörung der kirchlichen Einheit durch die Handlungen der Häresien entgegenzutreten. Es ist offensichtlich, dass die Teilnahme, Zustimmung und Zusammenarbeit des Bischofs von Rom und folglich der „bis an die Enden des Ozeans [reichende]“ Kirche bei den Entscheidungen der Konzile notwendig war, vor allem um die Einheit zu bewahren und so die Entstehung einer Kirchenspaltung zu verhindern. Als dies gelang, waren die Freude und Begeisterung der Kirchenväter besonders deutlich und wurde auf intensive Weise zum Ausdruck gebracht.
- Das Ökumenische Konzil übt seine Entscheidungen mit absoluter Autorität aus, ohne vom Willen oder den Entscheidungen einzelner Personen abhängig zu sein. Und diese Beschlüsse wurden von der gesamten alten Kirche im Osten und Westen gänzlich akzeptiert. So wurden Entscheidungen in Abwesenheit des Bischofs von Rom oder sogar trotz seines kategorischen Widerstands getroffen. Darüber hinaus war die Prüfung durch das Konzil selbst in den Fällen, in denen seine Vorschläge angenommen wurden, aufgrund der bisher geltenden kirchlichen Tradition vorausgegangen, und solange die Zustimmung des Konzils sichergestellt war, wurden die Vorschläge Roms akzeptiert. In der „konziliaren Abstimmung“, dem Gipfel des Fünften Ökumenischen Konzils wurde die Stellung der alten Kirche auf offiziellster sowie kategorischster Weise aufgezeichnet: „bei den gemeinsamen Sitzungen hat das Licht der Wahrheit die Dunkelheit der Lüge aufgelöst, da dort die von einer Seite zur Diskussion gestellten Themen einer Prüfung unterzogen wurden. Denn in Glaubensfragen aber hat keiner das Recht, im Namen der gesamten Kirche vorschnell zu urteilen, da wir alle auf unsere Nächsten angewiesen sind.“ Nicht wäre es übertrieben zu meinen, das [Fünfte] Ökumenische Konzil habe im Heiligen Geist die Entwicklung des Westens vorweggenommen und das Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils zur Unfehlbarkeit ausdrücklich und eindeutig verurteilt: Für das Konzil kann der Papst weder ex sese noch ex consensu Ecclesiae unfehlbar sein.
- Der Vorrang des Bischofs von Rom, aber gleichzeitig auch die Gleichheit der fünf Patriarchen, wird durch die „Unterschriftsformulare“ der Konzilsbeschlüsse bezeugt. Alle Patriarchen sowie Bischöfe unterzeichneten an jenen „Stellen“ und in einheitlicher Weise gemäß der Ehrenrangordnung der patriarchalischen Throne. Natürlich unterschrieb der Bischof von Rom als Erstgethronter. Der Papst hatte nie eine besondere Art der Unterschrift beansprucht, noch konnte man ihm eine solche gewähren.
D. Der Bischof von Rom und die heiligen Kanones.
- Die heiligen Kanones als Entscheidungen der Ökumenischen Konzilen spiegeln wider, aber zugleich bilden sie sowohl das Ethos und die Praxis der katholischen (allumfassenden, ganzheitlichen) Kirche. Folglich kann eine Missachtung der Autorität des Konzils und der Gültigkeit der Kanones nicht geduldet werden.
- Grundlegende Kanones, die sich auf den Ehrenrang der erstgethronten patriarchalischen Kirchen beziehen, sind A-6, A-7, B-3, D-28 und St-36. Am entscheidendsten für die Stellung des Bischofs von Rom in der alten Kirche ist der Kanon D-28, welcher den Kanon B-3 interpretiert und die Grundlage für den Kanon St-36 bildet. Die Bedeutung von D-28 liegt in seinem Inhalt, aber auch im Veröffentlichungsverfahren. a) Bezüglich des Inhalts: Es umgibt zwar den Ehrenrang Roms mit kanonischer Autorität und verleiht dem Stuhl von Konstantinopel „die gleichen Vorrechte“ wie die von Rom, greift aber zugleich den Hauptpunkt an, auf dem — so die AnsichtRoms — die Überlegenheit des päpstlichen Throns über die anderen Patriarchenthrone beruht: die „felsenfeste“ Apostolizität und den „von Gottes Gnaden“ verliehenen Autoritätsvorrang über die gesamte Kirche. b) Was das Veröffentlichungsverfahren betrifft: Der kategorische Widerstand von Papst Leo und die heftige Reaktion der römischen Kirche haben den Kanon D-28 nicht nur bekräftigt, sondern auch sein Ansehen, seine Macht und seine Ökumenische Gültigkeit bestätigt. Und das war für die kirchliche Ordnung selbstverständlich, denn für die alte Kirche war es undenkbar, dass eine Ortskirche oder eine Person einen Synodenbeschluss oder gar ein Ökumenisches Konzil für nichtig erkläre. Nicht einmal dem Papst in Rom wurde das Recht zuerkannt, die Beschlüsse der Konzile zu billigen oder abzulehnen. Im Gegenteil, er war verpflichtet, dieser Aufforderung nachzukommen.
- Die römischen Ansichten, die Papst Leo der Große mit besonderem Nachdruck unterstützte hinsichtlich der „felsenfesten“ Apostolizität der Kirchen von Rom, Alexandrien und Antiochien und der Gewährung von Gesandtschaften an sie auf Grundlager jener Apostolizität, bekamen keine kanonische Grundlage und übten keinen Einfluss auf das Leben der antiken Kirche aus. Sogar Rom selbst akzeptierte sie in der Praxis nicht und gab sie bald auf.
- Das sechste Ökumenische Konzil von Trullo (Penthekte) verurteilt in fünf Kanons Bräuche, die in der Kirche von Rom vorherrschend waren.
E. Der Bischof von Rom im Osten und im Westen. „Der Beginn der Vielfalt in der Einheit“.
Im offiziellen Theologischen Dialog der Orthodoxen Kirche mit Rom wurde das berühmte „Prinzip der Verschiedenheit in der Einheit“ als Vorschlag zur Überwindung der Sackgasse vorgelegt, die durch die päpstlichen Lehren bei der Union der Kirche entstanden ist. Dieser Vorschlag basiert nach Ansicht seiner Befürworter auf der Entscheidung des Konzils von Konstantinopel von 879 bis 880[1], setzt in der vorgeschlagenen Weise jedoch im Wesentlichen das Dekret „über den Ökumenismus“[2] des Zweiten Vatikanischen Konzils[3] um und strebt die Einheit der Kirchen in der Vielfalt der Lehren an. Das heißt, die im Westen sollen das Dogma über den Apostel Petrus und die Dogmen des päpstlichen Primats und der Unfehlbarkeit akzeptieren, wie sie im ersten und im Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurden, ohne jedoch die Forderung zu haben, sie dem Osten aufzuzwingen, während die Orthodoxen in der Lage sein sollen, sie nicht zu akzeptieren, sie aber auch nicht als ketzerische Abweichung vom alten Glauben und der Praxis der Kirche zu bezeichnen, gemäß der Formulierung des damaligen Kardinals J. Ratzinger und späteren Papstes Benedikt XVI[4]! Diesem Vorschlag zufolge habe auch die alte Kirche folgendermaßen gehandelt: Der Westen akzeptierte den päpstlichen Autoritätsprimat, ohne ihn dem Osten aufzuzwingen, und der Osten tolerierte diese Differenzierung des Westens, ohne sie als ekklesiologische Abweichung zu verurteilen. Der Osten und der Westen glaubten unterschiedlich, und trotz alledem stehen wir in voller kirchlicher Gemeinschaft[5]. Anders ausgedrückt: „Legitime Unterschiede stehen der Einheit der Kirche keineswegs entgegen; im Gegenteil, sie erhöhen ihre Schönheit und tragen in nicht geringem Maße zur Erfüllung ihrer Sendung bei“[6].
Bevor wir mit der notwendigen kurzen Kritik dieses Vorschlags fortfahren, ist es notwendig, seine wahre Dimension zu entschlüsseln. Besonders aufschlussreich in diesem Punkt war die Rede von Papst Johannes Paul II. vor den katholischen Ostpatriarchen (Uniaten) am 29.9.1998.
Der Papst wandte sich unter anderem an die unierten Patriarchen [mit folgenden Worten]: „Ich bitte Sie, dem Papst im Namen Ihrer Verantwortung bei der Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen zu helfen (OL § 24). Sie tragen Verantwortung, denn Sie sind die Patriarchen der Kirchen, die mit der Orthodoxie einen großen Teil der theologischen, liturgischen, spirituellen und kanonischen Tradition teilen. Deshalb wünsche ich mir, dass Ihre Kirchen vollwertige Partner im ökumenischen Dialog der Liebe und im theologischen Dialog sind, sei es auf lokaler oder globaler Ebene“, fuhr der Papst fort. „Die besondere Rolle der katholischen Ostkirchen (Anm.: Unierten) entspricht jener, die aufgrund der fehlenden vollen Gemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen leer bleibt. Sowohl das Dekret Orientalium Ecclesiarum des Zweiten Vatikanischen Konzils als auch das Apostolische Dekret Sacri Canones (S. IX-X9, mit dem der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium veröffentlicht wurden, machten deutlich, wie sehr die bestehende Situation und die sie regelnden Normen auf die so sehr ersehnte volle Gemeinschaft zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen ausgerichtet sind. Ihre Zusammenarbeit mit dem Papst wird den orthodoxen Kirchen zeigen, dass die Tradition der ‚Synergie‘ zwischen Rom und den Patriarchaten — wenn auch begrenzt und fragmentiert — fortbesteht und sich sogar zum Wohle der einen Kirche Gottes, die sich über die ganze Erde erstreckt, weiterentwickeln kann“[7].
Aus dem oben Erwähnten geht klar hervor, dass Rom — trotz gegenteiliger Beteuerungen[8] — die volle Gemeinschaft mit der Orthodoxie auf Grundlage einer verbesserten Fassung der Union[9] anstrebt, die auch die Orthodoxen einschließen kann.[10] Zu diesem Zweck ist der Beitrag des Prinzips der „Vielfalt in der Einheit“ entscheidend[11], auch wenn es in seiner Darstellung weder historisch bestätigt noch theologisch akzeptierbar ist.
Die Untersuchung der Praktiken und Entscheidungen der ökumenischen Konzile zeigt, dass die Behauptung, in der alten Kirche des ersten Jahrtausends habe es im Osten und im Westen unterschiedliche Ansichten über die Stellung des Bischofs von Rom gegeben, historisch unbegründet ist. Im Gegenteil: Es zeigt sich deutlich, dass trotz Anerkennung des Apostolischen Stuhls in der Kirche von Rom, dem Ursprungsort des Petrus, aber auch in der westlateinischen Kirche selbst, keine Form päpstlicher Höchstjurisdiktion (primäre Autorität) über die gesamte Kirche annehmbar war, noch wurde dem Papst das alleinige Recht zuerkannt, seinen Glauben kundzutun — er wurde ja sogar als unfehlbar anerkannt. Wir erinnern kurz daran:
- Die Akzeptanz der synodalen Kontrolle der dogmatischen Briefe der Hl. Päpste Leo, Agatho und Hadrian durch die päpstlichen Legaten mit der Frage, ob sie mit der kirchlichen Tradition im Einklang stehen.
- Die Ansichten des hl. Papstes Leo des Großen gegen D-28, die selbst von seinen Nachfolgern nicht akzeptiert wurden und im Westen bis zur Zeit der Kirchenspaltung bald aufgegeben wurden.
- Die grundsätzliche Weigerung der westlichen lateinischen Bischöfe, die Glaubensentscheidungen des römischen Papstes Vigilius zu akzeptieren, und infolgedessen die wiederholten verurteilenden Entscheidungen westlicher Synoden (vor und nach dem Fünften Ökumenischen Konzil) ausdrücklich gegen jenen Papst.
- Das wiederholt zum Ausdruck gebrachte Selbstbewusstsein von Papst Vigilius selbst, der nie eine angeblich von Gott verliehene höhere Macht oder „felsenfeste“ Autorität beanspruchte, auf deren Grundlage die Kirche und die anderen Patriarchen ihm gegenüber zum Gehorsam verpflichtet wären. Auch hat Papst Vigilius die Frage der Nichtkanonizität oder Ungültigkeit des Fünften Ökumenischen Konzils aufgrund seiner Meinungsverschiedenheit und Abwesenheit nicht angesprochen. Im Gegenteil versprach er ausdrücklich, dass er sich jeder Glaubensentscheidung des Ökumenischen Konzils unterwerfen würde und hielt die ihn verurteilende Entscheidung für gerecht.
- Dass die Einberufung der Synode von 125 Bischöfen aus allen Verwaltungsgebieten des Patriarchats von Rom unter dem Vorsitz des heiligen Papstes Agatho zur synodalen Behandlung und Entscheidung über die Häresie des Monotheletismus die Praxis und das solide ekklesiologische Ethos der alten Kirche von Rom demonstriert. Auch der Bericht des Konzils von Rom ist bezeichnend: „Wir haben uns mit großer Mühe versammelt“ aus „den Enden des Ozeans“, mit dem Ziel, im Konzil Rat zu halten, „damit aus der gesamten Gemeinschaft des Konzils von uns Dienern unser nächster Bericht hervorgehe. … Damit, wenn nicht einseitig bekannt wird, was getan wird, eine Partei nicht im Unrecht liege.“
- Roms Mitschuld an der Verurteilung von Papst Honorius auf dem Sechsten Ökumenischen Konzil.
- Dass der Westen eine entscheidende Rolle des Kaisers im Verfahren des Konzils akzeptierte und nie darauf bestand, dass die päpstlichen Stellvertreter den Vorsitz sowohl des ökumenischen als auch des lokalen Konzils des Westens übernommen haben.
- Dass eine Reihe von Kanones lokaler Synoden und von Kirchenväter, die von St-2 und G-1 ratifiziert wurden, bezeugen, dass die alte westlich-lateinische Kirche in der Kirche von Rom und ihrem Bischof, wie auch im Osten, großen Respekt und Vorrang der Ehre erkannte, nicht jedoch den Vorrang der Gerichtsbarkeit oder die unfehlbare Bestimmung des Glaubens. Dies ist beispielsweise in den Protokollen der Konzile der lateinischen nordafrikanischen Kirche in Cartagena und ihren Entscheidungen zum Verbot der Berufung nach Rom oder im Streit zwischen Papst Stephan und dem heiligen Cyprian von Karthago über die Taufe von Ketzern zu sehen.
- Schließlich bringt der Epilog des Briefes des Konzils von Karthago am deutlichsten die Gefahr zum Ausdruck, die die lateinischen Väter des Nordens voraussahen. Afrika stand bei seiner Entstehung unter der Forderung Roms, seine Gerichtsbarkeit auf das Urteil der afrikanischen Bischöfe auszudehnen: „Wenn sie ihre Geistlichen aussenden, werden sie einige von ihnen, die darum bitten, nicht senden und ihnen auch nicht die Erlaubnis erteilen, damit wir nicht den rauchigen Sturm der Welt in die Kirche Christi bringen, die das Licht der Einfachheit und Demut denen bietet, die Gott sehen wollen.“
Das oben Stehende bestätigt, dass selbst in der westlichen Kirche während der Ära der Ökumenischen Konzile dem Bischof von Rom weder ein „besonderes Vorrecht“ noch ein „besonderes Amt der Einheit“ zuerkannt wurde, noch wurde ihm irgendeine höhere Autorität über die gesamte Kirche oder das Recht zugestanden, den Glauben unfehlbar zum Ausdruck zu bringen. Daher waren die sporadischen Äußerungen päpstlicher Vertreter oder bestimmte Briefe, selbst wenn sie als deklarative Ansprüche auf einen gewissen Autoritätsprimat interpretiert wurden, weder Ausdruck der gesamten westlichen Kirche, noch spiegelten sie die westliche Theologie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Patriarchats von Rom während dem Zeitalter der Ökumenischen Konzile wider. Folglich herrschten in den ersten acht Jahrhunderten der Kirche zwischen Ost und West übereinstimmende Ansichten über die grundlegenden ekklesiologischen Prinzipien hinsichtlich der Rolle der Bischöfe der Primatskirchen, einschließlich des Bischofs von Rom.
Darüber hinaus müssen wir, auch wenn wir bedenken, dass es in den ersten acht Jahrhunderten zwischen Ost und West erhebliche Meinungsunterschiedlichkeiten hinsichtlich des Wesens und der Rolle des Ehrenprimats von Rom gab — eine Tatsache, die, wie wir gezeigt haben, durch die Praxen und Entscheidungen der Ökumenischen Konzile nicht bestätigt wird —, darauf hinweisen, dass der Unterschied zur heutigen Realität nach der Dogmatisierung der angeblich höchsten Autorität des Apostels katastrophal ist. Sowohl Petrus über den anderen Aposteln als auch der päpstliche Primat als auch die Unfehlbarkeit im Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzil! Damals waren wir mit einfachen Feststellungen oder Interpretationen konfrontiert. Heute, nach diesen beiden Vatikanischen Konzilen, verfügen wir — laut Rom — über grundlegende Glaubenslehren, die zur „wesentlichen und unwiderruflichen Struktur der Kirche“ gehören und deren Leugnung als solche die Anathemas des „ökumenischen“ Ersten Vatikanischen Konzils nach sich zieht, die auch nach dem „ökumenischen“ Zweiten Vatikanischen Konzil weiterhin in Kraft bleiben.
Folglich ist der Versuch mancher Kreise, die päpstlichen Dogmen des Ersten Vatikanums als gleichwertig mit einigen Aussagen päpstlicher Bullen oder päpstlicher Briefe der alten Kirche darzustellen, eindeutig nicht überzeugend.
Auch die Anwendung des „Prinzips der Verschiedenheit in der Einheit“ nicht auf kleinere kirchliche Bräuche, sondern auf grundlegende kirchliche Dogmen, die die Struktur und Hypostase der Kirche selbst berühren[12], ist aus kirchlicher Sicht inakzeptabel. Wenn nach der päpstlichen Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums die Leugnung päpstlicher Dogmen ein schwerwiegendes ekklesiologisches Defizit[13] darstellt, dann haben wir keine Kirche Christi, denn das Bestehen einer Kirche mit ekklesiologischen Mängeln ist völlig undenkbar! Außerdem ist es undenkbar, dass der westliche Teil der neu konstituierten(?) „Vereinigten Kirche“ die Lehren über den Apostel Petrus, den päpstlichen Primat und die Unfehlbarkeit (gemäß dem Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzil) als ekklesiologisch grundlegende Dogmen betrachte und der östliche Teil sie leugne. Zu keiner Zeit im Leben der Kirche Christi waren die Glaubensdogmen nur für alle Gläubigen einer bestimmten territorialen Region (oder eines bestimmten Ordens!) verbindlich, während in einer anderen Region die Möglichkeit bestand, sie nicht anzunehmen. Es ist nicht vorstellbar, dass wir derselben „vereinigten Kirche“ angehören und dass die im Westen die Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra predigt, als ein für das Seelenheil notwendiges Glaubensdogma akzeptieren, während der Rest dies kategorisch leugnet.
Es ist daher offensichtlich, dass das Prinzip der „Vielfalt in der Einheit“, wie es kürzlich interpretiert wurde, und der daraus resultierende Vorschlag des Kardinals und späteren Papstes Benedikt XVI. für die Orthodoxe Kirche unvorstellbar sind.
Wenn also das „Prinzip der Vielfalt in der Einheit“, wie es kürzlich vorgestellt wurde, nicht auf die lang ersehnte Vereinigung von Ost und West anwendbar ist, welcher Vorschlag wäre dann angemessen, um die Spaltung unter den Christen zu überwinden? Ich glaube, die einzige Hoffnung auf die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit liegt einzig und allein in aufrichtiger Reue. Diese setzt die demütige Rückkehr zu den theologischen Grundprinzipien und Bedingungen voraus, nach denen die Kirche der Ökumenischen Konzile lebte — und wird gleichzeitig durch sie verwirklicht. Demut wird göttliche Gnade anziehen, und dann wird kein unhaltbarer diplomatischer Kompromiss mit zweideutigen Formulierungen, der nur Bitterkeit und Probleme schafft, sondern die wahre und echte „Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes“ verwirklicht.
[1] MANSI 17, 489B: „Das heilige Konzil sagte: ,Jeder Thron hat seit jeher bestimmte uralte Traditionen; und es hat keinen Sinn, darüber zu streiten und zu zanken; denn die römische Kirche hält ihre Jahre ein, und das ist richtig; auch die Kirche von Konstantinopel bewahrt eigene Traditionen, die sie von oben empfangen hat. Ebenso die Throne des Ostens.‘ Das Konzil spricht jedoch, wie weiter unten erwähnt wird, von der Konklave-Ordination und nicht von theologischen Fragen von grundlegender Bedeutung, die die Struktur und das Wesen der Kirche und des Glaubens betreffen, wie es die päpstlichen Dogmen für Rom sind.
[2] Für eine detailliertere Analyse der Ekklesiologie des Urchristentums aus orthodoxer Sicht siehe P. Hirsch, The Ecclesiological Review of the Second Vatican Council, Uncut Mountain Press, Petrokerasa Thessaloniki 2014.
[3] „Wir können ohne Vorbehalt sagen, dass wir im ,Herzen‘ des Dekrets dem Thema der Einheit und der Vielfalt begegnen. Und obwohl dieses Thema in den drei Kapiteln des Textes nicht explizit dargestellt wird, stellt es dennoch eine Lesart und einen Zusammenhang des gesamten Textes dar“, siehe W. Henn, „At the Heart of Unitatis Redintegratio: Unity in Diversity“, Gregorianum 88 (2007) 2, 330 ff. „Dekret über den Ökumenismus“, § 16-18, in: Das Zweite Vatikanische Konzil. Dekrete-Dekrete-Erklärungen-Botschaften, hrsg. Io. Asimakis — L. Kiskinis, Analecta Theologica 8, hrsg. Apostolisches Vikariat Thessaloniki, Thessaloniki 2012, S. 483: „Die Kirchen des Ostens folgten von Anfang an ihrer eigenen kanonischen Ordnung, die von den Heiligen Vätern und den Konzilen, auch den Ökumenischen, ratifiziert wurde. Eine gewisse Vielfalt an Sitten und Gebräuchen steht, wie bereits erwähnt, der Einheit der Kirche keineswegs im Wege, sondern erhöht ihre Schönheit und stellt eine unschätzbare Hilfe bei der Erfüllung ihrer Mission dar. Um alle Zweifel auszuräumen, erklärt die Heilige Synode daher, dass die Kirchen des Ostens im Bewusstsein der notwendigen Einheit der Gesamtkirche die Autorität haben, ihre eigene kanonische Ordnung zu regeln, die dem Charakter ihrer Gläubigen am besten entspricht und das Wohl der Seelen am besten fördert. Die vollkommene Einhaltung dieses traditionellen Prinzips, das freilich nicht immer beachtet wurde, gehört zu den Voraussetzungen, die für die Wiederherstellung der Einheit unbedingt erforderlich sind. Was zuvor über die legitime Vielfalt gesagt wurde, gilt auch für die unterschiedliche Formulierung theologischer Lehren“, siehe auch die päpstliche Enzyklika „Auf dass sie alle eins seien“ („Ut unum sint“) des Heiligen Vaters Johannes Paul II. Zur ökumenischen Pflicht, 25. Mai 1995, Libreria Editrice Vaticana, Vatikanstadt, § 57. Der Vorschlag der „Einheit in der Vielfalt“ wurde von Papst Leo XIII. als Grundlage für die Union der Christen vorgelegt, worauf das Konzil von Konstantinopel 1895 antwortete, in: I. Karmiri, Die dogmatischen und symbolischen Denkmäler der Orthodoxen Katholischen Kirche, Bd. 2, Athen 1953, S. 934 ff. In diesem Kontext bewegt sich auch das „Dekret über die katholischen Ostkirchen“ (Orientalium Ecclesiarum), siehe das Zweite Vatikanische Konzil: Verordnungen-Dekret-Erklärungen-Botschaften, hrsg. Io. Asimakis — L. Kiskinis, Analecta Theologica 8, hrsg. vom Apostolischen Vikariat Thessaloniki, Thessaloniki 2012, S. 491.
[4] J. Ratzinger meint dazu: „…Rom muß vom Osten nicht mehr an Primatslehre. Fordern, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. … Die Einigung könnte hier auf der Basis geschehen, daß einerseits der Osten darauf verzichtet, die westliche Entwicklung des zweiten Jahrtausends als häretisch zu bekämpfen und die katholische Kirche in der Gestalt als rechtmäßig und rechtgläubig akzeptiert, die sie in dieser Entwicklung gefunden hat, während umgekehrt der Westen die Kirche des Ostens in der Gestalt, die sie sich bewahrt hat, als rechtgläubig und rechtmäßig anerkennt.“ (J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre: Bausteine zur Fundamentaltheologie, München 1982, S. 209). Der Vorschlag des (damaligen) Metropoliten der Schweiz, Herrn Damaskinos („Was im Petrusamt dauerhaft und veränderlich ist. Gedanken aus orthodoxer Sicht“, Stachys, 52-67(1977-1981) 508, D. Papandreou, „Ein Beitrag zur Überwindung der Trennung zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche“ in Vasilios von Aristi, Das Päpstliche Amt: Dienst oder Hindernis für die Ökumene? Regensburg 1985, S. 162, 166-167), von H. Scutte, in Chrys. Savvatos (heute Metropolit von Messinia), Päpstlicher Vorrang im Dialog zwischen Orthodoxen und Katholiken, Athen 2006, S. 14 und E. Lanne, in Damaskinos, „Was ist beständig und was ist veränderlich im versteinernden Amt? Gedanken aus orthodoxer Sicht“, Stachys, 52-67 (1977-1981), S. 516-517.
Zu Ratzingers Aussage möchte ich eine sehr schmerzliche Bemerkung machen: Es ist besonders tragisch, dass eine ganze Ortskirche — die größte, an Ruhm reichste und zugänglichste des ersten Jahrtausends — in eine solche Verwirrung geraten ist, dass sie:
- die Geschehnisse des zweiten Jahrtausends in Bezug auf den päpstlichen Primat als positive theologische Entwicklung und Fortschritt betrachtet!
- die Leugnung der göttlich inspirierten, kanonischen, kirchlichen Ordnung und Tradition der Ökumenischen Konzilen als theologischen Fortschritt betrachtet!
- die auf den Fälschungen des düsteren Mittelalters (der Pseudokonstantinischen Schenkung und den Pseudoisidorianischen Dekreten) beruhende päpstliche Institution als theologischen Fortschritt zu betrachten (Kreta-Entwurf, § 15)!
Ich bitte darum, diese Aussage nicht als feindselig oder kriegerisch gegenüber den Katholiken zu verstehen, sondern lediglich als Ausdruck von Trauer und Schmerz und zugleich Angst und Besorgnis für uns Orthodoxe!
[5] Diese Position wurde im „Kretischen Projekt“ in den §§ 15, 22 und insbesondere im letzten § 32 ausdrücklich formuliert: „Die Erfahrungen des ersten Jahrtausends beeinflussten die Beziehungen zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens nachhaltig. Trotz der wachsenden Distanz und der zeitweiligen Schismen in dieser Zeit blieb die Gemeinschaft zwischen Ost und West bestehen. Das Prinzip der Vielfalt in der Einheit, das auf dem Konzil von Konstantinopel in den Jahren 879-80 kategorisch angenommen wurde, ist für das Thema in der gegenwärtigen Phase unseres Dialogs von besonderer Bedeutung. Klare Dimensionen in Wahrnehmung und Interpretation hinderten Ost und West nicht daran, in Gemeinschaften zu bleiben. Es herrschte ein starkes Bewusstsein für die Existenz einer Kirche und die Entschlossenheit, in Einheit zu bleiben wie eine Herde mit einem Hirten (Joh. 10,16). Das erste Jahrtausend, das in dieser Phase unseres Dialogs untersucht wurde, ist die gemeinsame Tradition unserer beiden Kirchen. In den hier identifizierten theologischen und ekklesiologischen Grundprinzipien sollte diese gemeinsame Tradition dienen als Modell für die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft.“ Auf ähnlicher Weise hat auch Damaskinos von Tranoupolis dies unterstützt in: „Was ist dauerhaft und was ist veränderlich im Dienst des Petrus? Gedanken aus orthodoxer Sicht“, Stachys, 52-67 (1977-1981) 508.
[6] Enzyklika „Auf dass alle eins seien“ (ut unum sint) des Heiligen Vaters Johannes Paul II. über die ökumenische Aufgabe, 25. Mai 1995, § 50, Liberia editrice Vaticana, Vatikanstadt, S. 11. 62.
[7] „Le rôle particulier des Églises orientales catholiques correspond à celui qui est resté vacant à cause du manque de communion complète avec les Églises orthodoxes. Aussi bien le Décret Orientalium Ecclesiarum du Concile Vatican II que la Constitution apostolique Sacri canones (p. IX-X) qui a accompagné la publication du Code des canons des Églises orientales, ont mis en évidence combien la situation présente, et les règles qui la régissent, sont dirigées vers la pleine communion tant souhaitée entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes. Votre collaboration avec le Pape et entre vous pourra montrer aux Églises orthodoxes que la tradition de la «synergie» entre Rome et les Patriarcats s'est maintenue - bien que limitée et blessée -, qu'elle s'est peut-être même développée pour le bien de l'unique Église de Dieu, répandue par toute la terre“, La documentation catholique, no 2192, 15.11.1998. σ. 951-953 καί στό διαδικτυακό τόπο : www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documents/ Actes-du-Pape/Aidez-l-eveque-de-Rome-dans-sa-reflexion-sur-son-ministere-d-unite-2013-04-09-935467
[8] „Das Heilige (Zweite Vatikanische) Konzil ist hocherfreut über die fruchtbare und tatkräftige Zusammenarbeit der katholischen Ost- und Westkirchen. Gleichzeitig erklärt es: Alle Rechtsbestimmungen dieses Dekretes gelten nur für die gegenwärtigen Verhältnisse, bis die katholische Kirche und die getrennten Ostkirchen zur Vollendung der Gemeinschaft zusammenfinden.“ (OE § 30, in: Zweites Vatikanisches Konzil, Texte, S. 504). Das Konzil freut sich jedoch sehr über die bisherige Arbeit der Union …
[9] Zur Union im theologischen Dialog mit Rom, siehe Th. Zisis, Οὐνία, Ἡ καταδίκη καὶ ἡ ἀθώωση [Union: Die Verurteilung und der Freispruch], hrsg. Vryennios, Thessaloniki 2002; G. Kapsani, Οὐνία, Ἡ μέθοδος τοῦ παποκεντρικοῦ Οἰκουμενισμοῦ [Union: Die Methode des papstzentrischen Ökumenismus], Parakatathiki, 60 2008), 3-10. Zur historischen Herangehensweise an die Unia siehe G. Metallinos, D. Gonis, I Fratseas, Ev. Morarou, Bischof von vanat Athanasios (Jevtić), Ἡ Οὐνία, χθὲς καὶ σήμερα [Die Union, gestern und heute], hrsg. Armos, Athen 1992. Eine ausführlichere Bibliographie zur Unia findet sich in K. Kotsiopoulos, Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία [Die Union in der griechischen theologischen Bibliographie], hrsg. Vryennios, Thessaloniki 1993.
[10] Es ist charakteristisch, dass Rom die Bestimmungen des „Dekrets über die katholischen Ostkirchen“ als „eine Art ,Garantie‘ dafür darstellt, dass die Wiederentdeckung der Gemeinschaft mit Rom keinen Verzicht auf die wesentlichen Elemente nicht-lateinischer kirchlicher Traditionen bedeutet“! (II. Vatikanum: Dokumente, S. 491.)
[11] Th. Zisis, „Ἡ οὐνία ὡς πρότυπο ψευδοῦς ἑνότητος. Τὰ ὅρια τῆς ποικιλομορφίας ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἑνότητα [Einheit als Modell falscher Einheit. Die Grenzen der Vielfalt im Verhältnis zur Einheit]“, — «Πρωτεῖον» Συνοδικότης καὶ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας, Πρακτικὰ Θεολογικῆς Ἡμερίδος [Prototheon“ Synodalität und Einheit der Kirche, Vorgang des Theologischen Seminars], hrsg. Heilige Metropole Piräus, Piräus 2011, S. 107-114.
[12] Congregatio pro Doctrina Fidei, Schreiben Communionis Notio, § 17.3 (28.5.1992), auf der Webseite www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html.
[13] „Unitatis Redintegratio“ („Dekret über den Ökumenismus“), Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils § 3, in II. Vatikanum, Dokumente, S. 471. I. Maragou, Οἰκουμενικὰ Α΄ [,Ökumeniken‘ I.], Athen 1986, S. 33, und die Antwort vom 29.6.2007 der Kommission für die Glaubenslehre (Congregatio pro Doctrina Fidei) der Römischen Kurie, auf der Webseite www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_200 70629_responsa-quaestiones_en.html.







