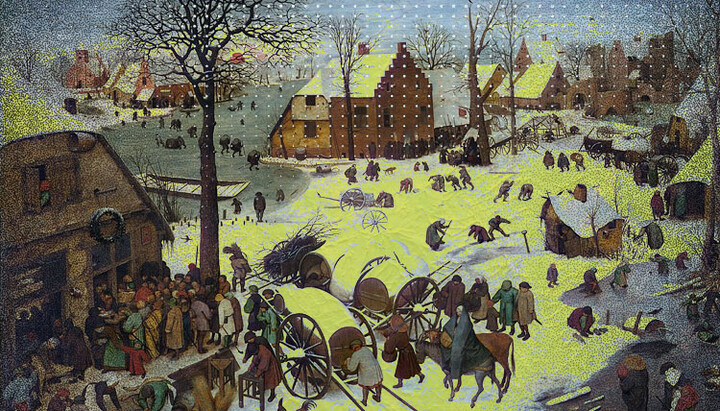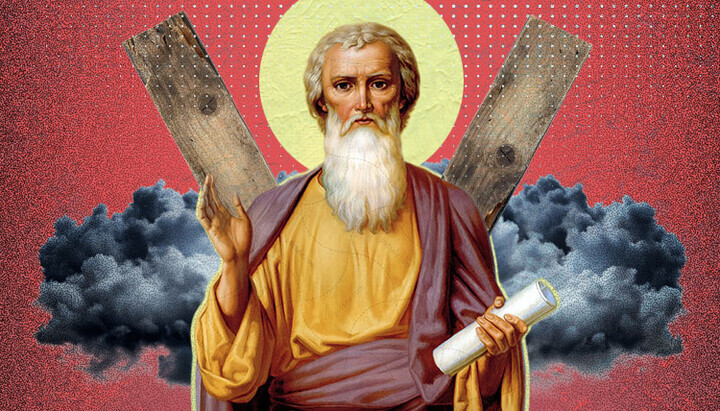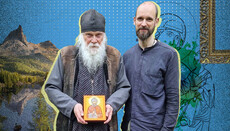Neumärtyrer des 20. Jahrhunderts: Metropolit Anatolij von Odessa

Der Hieromärtyrer Anatolij begann sein Leben als Wissenschaftler und Lehrer und endete als Märtyrer und Bekenner. Welche Lehren können wir aus seinem Leben ziehen?
Frühe Jahre
Der künftige Hieromärtyrer Anatolij, Metropolit von Odessa und Cherson, wurde am 20. (nach anderen Quellen 19.) August 1880 in der Stadt Kremenets (nach anderen Quellen in Kovel) in der Provinz Wolhynien geboren. Sein Name in der Welt war Andrej Grigorjewitsch Grisyuk. Sein Vater war ein kleiner Beamter, ein Buchhalter der Bezirkskasse von Kremenets.
Die Familie, in der es außer Andrej noch zwei Kinder gab, die Töchter Raisa und Sophia, lebte in ärmlichen Verhältnissen. Die Kinder mussten von klein auf zu Hause mithelfen und die anfallenden Arbeiten erledigen.
Vorausschauend lässt sich sagen, dass die Armut ihn fast sein ganzes Leben lang begleitete, selbst nachdem er Bischof geworden war, gab er sehr wenig für sich selbst aus, und das Bischofsamt war in den 1930er Jahren überhaupt keine lukrative Sache.
Die Ausbildung und der Beginn seiner kirchlichen Tätigkeit
Sein Werdegang vor der Revolution von 1917 ist ein typischer Werdegang eines russischen Bischofs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Ein frommer Jugendlicher, der in der Gemeinde-Schule seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, tritt in ein Priesterseminar ein, dann in eine Akademie. Dann das Mönchtum, die Priesterweihe und die Besetzung von Stellen im Bereich der geistlichen Bildung. Danach - die Bischofsweihe.
Das Leben des künftigen Metropoliten Anatolij verlief in ähnlicher Weise. Zunächst war er Schüler an der Gemeinde-Schule von Kremenets. Dann, von 1894 bis 1900, im Theologischen Seminar von Wolhynien. Danach, im selben Jahr, trat er in die Theologische Akademie in Kiew ein. Im dritten Jahr seines Studiums an der Akademie wurde Andrej Grisyuk im August 1903 in der Lawra von Kiew mit dem Namen Anatolij in den Mönchsstand aufgenommen und zum Hierodiakon geweiht. Im Mai 1904 wurde er zum Priestermönch geweiht. Im Jahr 1904 schloss er sein Studium an der Kiewer Akademie ab und blieb dort, um zu lehren, zunächst als Professoren-Stipendiat und ein Jahr später als stellvertretender Dozent am Lehrstuhl für Allgemeine Kirchengeschichte.
Was in dieser Geschichte nicht ganz üblich war, war die Tatsache, dass Andrej Grigorjewitsch sich sehr ernsthaft mit der Kirchengeschichtswissenschaft beschäftigte.
Neben der allgemeinen Kirchengeschichte und der Patrologie galt sein wissenschaftliches Interesse dem frühöstlichen, genauer gesagt dem syrischen Mönchtum. Metropolit (damals Erzbischof) Antonij (Chrapowickij) äußerte sich über seine wissenschaftlichen und pädagogischen Fähigkeiten wie folgt: „Priestermönch Anatolij ist in der Kirchengeschichte ein begabter, wenn auch noch sehr junger, aber sehr kenntnisreicher Lehrer. Er wird ein Meister nicht nur in der Geschichte der Ereignisse des kirchlichen Lebens, sondern auch in der Theologie im Allgemeinen, d.h. in der Heiligen Schrift und der Patrologie. Mit einer perfekt entwickelten, präzisen und treffenden Sprache gelingt es ihm, in einer einzigen Vorlesung viele Ereignisse darzustellen, mehrere starke Charakterisierungen zu geben, das Wesentliche des abstraktesten Themas zu erklären, zum Beispiel die theologischen Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts“.
Während seines Studiums beherrschte er die wichtigsten europäischen Sprachen sowie einige orientalische Sprachen und konnte direkt mit den Originalen alter Handschriften arbeiten. In den Jahren 1905-1906 befand sich Priestermönch Anatolij auf einer Dienstreise zum Russischen Archäologischen Institut in Konstantinopel und betrieb dort wissenschaftliche Forschungen. Die Frucht dieser Arbeit war ein wissenschaftliches Werk: „Historische Skizze des syrischen Mönchtums bis zur Hälfte des VI. Jahrhunderts“, für das er 1911 den Grad eines Magisters der Theologie erhielt. Es handelte sich dabei nicht nur um eine vorübergehende Arbeit für einen Abschluss, sondern um einen vollwertigen Beitrag zur Wissenschaft.
In einer der Rezensionen heißt es: „Die gründliche Kenntnis der Primärquellen und der umfangreichen Literatur zum Thema, das tiefe Eindringen in den Geist des syrischen Anachoretentums, die Klarheit des Gedankens und die bildhafte Sprache zeichnen das Werk des Autors aus und machen es zu einem wertvollen Beitrag zur Literatur über dieses Thema“.
Im August 1911 wurde Vater Anatolij in den Rang eines Archimandriten erhoben, und einige Monate später erhielt er den damals sehr angesehenen akademischen Preis des Metropoliten Makarij (Bulgakow), der für herausragende wissenschaftliche Arbeiten verliehen wurde.
Im Oktober 1911 befasste sich der Rat der Kiewer Theologischen Akademie mit der Frage, ob Vater Anatolij, Dozent und Archimandrit, der Titel eines außerordentlichen Professors der Akademie verliehen werden sollte. Im Verlauf dieser Diskussion machte Professor F. Titov eine merkwürdige Aussage. Er sprach sich für die Verleihung des angestrebten Titels an Archimandrit Anatolij aus, verwies auf seine umfassende wissenschaftliche Tätigkeit und seine herausragenden pädagogischen Fähigkeiten und fügte hinzu: „Schließlich sind sich alle Mitglieder des Rates zweifellos der äußerst angespannten finanziellen Lage bewusst, in der er sich befindet...“
Aber wie kann ein Lehrer an der Theologischen Akademie, ein außerordentlicher Professor und Archimandrit in eine solche Lage kommen? Das ist natürlich nur eine Spekulation, da wir nicht alle Umstände kennen, aber höchstwahrscheinlich hat Vater Anatolij keine Spenden angenommen, den Bewerbern bei der Aufnahme und dem weiteren Studium nicht geholfen, keine Bekanntschaft mit wohlhabenden Bürgern gemacht, die ihn dementsprechend nicht zu Gottesdiensten riefen, und seine ganze Zeit und Energie seinen Studenten und seiner wissenschaftlichen Arbeit gewidmet.
Im Jahr 1912 erhielt Vr. Anatolij den Titel eines außerordentlichen Professors und einen nach Professor V.F. Pevnitskij benannten Preis für die Predigten, die er in der Fastenzeit bei den Passionsgottesdiensten gehalten hatte. Im Juni 1912 wurde er zum Inspektor und außerordentlichen Professor der Moskauer Theologischen Akademie ernannt, und ein Jahr später zum Rektor der Kasaner Theologischen Akademie. Im Jahr 1913, am Gedenktag der Apostel Petrus und Paulus, wurde er zum Bischof von Chistopolsk und zum Vikar der Diözese Kasan geweiht. Im Jahr 1914 brach der Erste Weltkrieg aus.
Der Erste Weltkrieg
An dieser Stelle ist es sinnvoll, ein wenig über diesen Krieg zu sprechen, denn er beeinflusste das Schicksal aller Menschen, die damals lebten. Auch wir erleben heute einen Krieg, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, und wir verstehen teilweise die Situation von vor einem Jahrhundert. Wer war im Ersten Weltkrieg der Aggressor und wer war das Opfer? Das möge jeder für sich selbst entscheiden, aber hier ein paar nüchterne Fakten: Russland war tatsächlich das erste Land, das eine groß angelegte Mobilisierung beschloss. Es weigerte sich, sie abzusagen, um die Situation auf Bitten Deutschlands zu entschärfen.
Russland griff zu Beginn des Krieges Ostpreußen an, d. h. es drang in das Hoheitsgebiet eines fremden Landes ein, und die russischen Expeditionskorps kämpften weit über die Grenzen Russlands hinaus. Es gab aber auch Tausende von Verwundeten, Mittellosen und Obdachlosen.
Was sollte ein Christ in dieser Situation tun? Wie sollte er handeln, was sollte er fordern, wen sollte er unterstützen?
Egal, ob das eigene Land im Recht ist oder nicht, ein Christ muss unter allen Umständen das Gebot Jesu Christi über die Gottes- und Nächstenliebe erfüllen, muss Taten der Barmherzigkeit an bestimmten Menschen vollbringen, die sich in der Nähe befanden, ohne zu prüfen, ob sie für die richtige Sache kämpfen oder nicht. Genau das hat Bischof Anatolij getan.
In der Diözese Kasan war er der Initiator und Organisator vieler karitativer Einrichtungen. So leitete er beispielsweise das Kasaner Komitee für die Unterstützung Bedürftiger und appellierte an Geistliche und Laien, den Familien von Soldaten zu helfen, die an die Front gegangen waren und keinen Ernährer mehr hatten. Er organisierte eine Krankenstation für Verwundete an der Kasaner Theologischen Akademie und förderte die Eröffnung ähnlicher Krankenstationen in Klöstern. In kurzer Zeit gab es in fast allen Pfarreien der Diözese Kuratorien zur Unterstützung der Bedürftigen.
Im Herbst 1915 begann Russland, Niederlagen zu erleiden, und die Front begann, auf russisches Gebiet vorzurücken. Ungefähr 3 Millionen Menschen waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Kasan und viele andere Städte wurden von Flüchtlingsströmen überschwemmt. Unter diesen Umständen unternahm Vladyka Anatolij alle Anstrengungen, um ihnen zu helfen. Die Diözesan-Konferenz der Diözese Kasan beschloss, dass alle Geistlichen der Diözese einen monatlichen Beitrag zur Unterstützung der Flüchtlinge leisten sollten.
Leben unter Verfolgung
Doch schon bald kam ein neues, noch schlimmeres Unglück. Mit der Oktoberrevolution von 1917 begann eine beispiellose Verfolgung der Kirche. Im Jahr 1918 erließen die Bolschewiki einen Erlass, der die Tätigkeit aller theologischen Bildungseinrichtungen untersagte. Das Dekret enthielt jedoch ein Schlupfloch, das die private Erteilung von einer Art „Religionsunterricht“ erlaubte. Einige Seminare und Akademien nutzten dies aus.
Bischof Anatolij wandte sich auch an das Kasaner Ministerium für öffentliche Bildung mit der Bitte, Privatunterricht zuzulassen. Dem Antrag wurde stattgegeben, und Bischof Anatolij erhielt einen offiziellen Stempel. Die Bolschewiki nahmen der Akademie das Gebäude weg, so dass der gesamte Unterricht bei den Lehrern zu Hause stattfand. Die Sitzungen des Akademierats fanden in der Wohnung von Bischof Anatolij statt. Eine Zeit lang konnte die Akademie mit den Mitteln aus besseren Zeiten aufrechterhalten werden, doch schon bald musste man auf die Hilfe der Kirchengemeinden zurückgreifen, die Abzüge für den Unterhalt der Akademie vornahmen.
Obwohl die Akademie legal existierte, war sie bei den sowjetischen Behörden unerwünscht.
1921 fingen die Strafbehörden die Korrespondenz zwischen Bischof Anatolij und Patriarch Tichon ab, in der es auch um die Aktivitäten der Kasaner Akademie ging. Es wurde der Befehl erteilt, diese Aktivitäten einzustellen. Am 26. März 1921 wurde Bischof Anatolij verhaftet. Er und die Lehrer der Akademie wurden verhört. Da die Akademie zwar privat existierte, aber mit Genehmigung der sowjetischen Behörden legal arbeitete, wurde Bischof Anatolij zu einer relativ milden Strafe von einem Jahr Zwangsarbeit verurteilt.
Nach seiner Freilassung im Februar 1922 wurde Seine Eminenz Anatolij auf die Kathedra von Samara berufen. Aber auch hier ließen ihn die Bolschewiken nicht in Ruhe. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt in Samara wurde er nicht nur durchsucht, sondern es wurde auch eine Rolle mit angeblich in seinem Namen verfassten antisowjetischen Proklamationen untergeschoben. Die Proklamationen trugen die Unterschrift und das Siegel des Bischofs. Bischof Anatolij konnte jedoch beweisen, dass es sich um eine plumpe Fälschung handelte, mit der er nichts zu tun hatte, und wurde nach fast sechsmonatiger Haft wieder freigelassen.
Unmittelbar nach seiner Freilassung erhob Patriarch Tichon Vladyka Anatolij in den Rang eines Erzbischofs, und nur wenige Wochen später, im September 1923, verhaftete ihn die OGPU von Samara erneut, diesmal unter dem Vorwurf, antisowjetische Gerüchte verbreitet zu haben. Zur Strafe wurde er für drei Jahre in die Stadt Krasnowodsk in Turkmenistan verbannt. In einem seiner Briefe aus dem Exil heißt es: „Was uns betrifft, so studieren wir jetzt nicht so sehr die alte Kirchengeschichte, sondern wir sind Opfer der Tragödie der jüngsten russischen Kirchengeschichte.... Wir machen Geschichte, schreiben sie nicht (nur)...“
Die Deklaration des Metropoliten Sergij
Nach seiner Rückkehr aus dem Exil im Jahr 1927 kehrte Erzbischof Anatolij auf die Kathedra von Samara zurück und wurde zum ständigen Mitglied der Heiligen Synode unter Metropolit Sergij (Stragorodskij), dem stellvertretenden Locum Tenens, ernannt. Hier sollten wir auch einen kleinen Exkurs machen und sagen, was 1927 in unserer Kirchengeschichte bedeutsam war. In diesem Jahr erschien die berühmte Erklärung von Metropolit Sergij (Stragorodskij) über die vollständige Loyalität der Kirche gegenüber der gottlosen Sowjetmacht.
Diese Erklärung löste in der Kirche Verwirrung und große kirchliche Spaltungen aus, die bis heute nicht vollständig ausgerottet sind. Viele Bischöfe, Geistliche und Laien akzeptierten die Erklärung nicht, und viele wiesen darauf hin, dass Metropolit Sergij seine Befugnisse als stellvertretender Locum Tenens des Patriarchen weit überschritten habe.
Metropolit Peter (Poljanskij), der Locum Tenens des Patriarchen, der sich zu dieser Zeit im Exil befand, schrieb im Dezember 1929 an Metropolit Sergij, nachdem er von all diesen kirchlichen Ereignissen erfahren hatte: „Es fällt mir schwer, alle Einzelheiten der negativen Haltung gegenüber Ihrer Verwaltung aufzuzählen, gegen die es Proteste und Schreie von Gläubigen gibt, von Hierarchen bis zu den Laien. Das Bild, das vom kirchlichen Ruin gezeichnet wird, ist erschütternd. Pflicht und Gewissen erlauben es mir nicht, angesichts eines solchen bedauerlichen Phänomens gleichgültig zu bleiben. Ich wende mich an Ihre Eminenz mit der eindringlichen Bitte, diesen Fehler zu korrigieren, der die Kirche in eine demütigende Lage gebracht, Zwietracht und Spaltungen in ihr verursacht und den Ruf ihrer Vorsteher geschädigt hat; ebenso bitte ich Sie, auch andere Handlungen, die Ihre Autorität überschritten haben, zu beseitigen“.
Doch Metropolit Sergij kam der Bitte des Hierarchen, dessen Stellvertreter er war, nicht nach. Es entstand ein Phänomen, das später „Sergianismus“ genannt wurde: Unterwerfung (auch in kirchlichen Angelegenheiten) unter gottlose Autoritäten, die die Kirche zerstören wollten. Die Verteidiger der Position von Metropolit (später Patriarch) Sergij behaupteten, dass er auf diese erniedrigende Weise versuchte, die Kirche vor der totalen Zerstörung zu retten.
Die spätere Geschichte hat jedoch gezeigt, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllte, die Bolschewiken fuhren fort, die Kirche zu zerstören und erreichten fast ihr Ziel. Und wenn man anfangs davon ausging, dass nach der Erklärung von 1927 nur diejenigen, die ihr nicht zustimmten, Repressalien ausgesetzt sein würden, so zeigte sich später, dass weder die Unterstützung der Erklärung, noch die Loyalität zur Sowjetmacht, noch die Nähe zu Metropolit Sergij sie vor Repressalien bewahren konnte.
Der Dienst auf der Kathedra von Odessa
All dies betraf unmittelbar auch den Hieromärtyrer Anatolij. Er war ein Bischof, der die Erklärung von 1927 nicht nur akzeptierte und billigte, sondern sie auch direkt zusammen mit Metropolit Sergij unterzeichnete. Und auch nachdem die Welle des Unverständnisses und der Kritik an Metropolit Sergij unter Klerus und Gläubigen hochgeschwappt war, blieb Vladyka Anatolij einer seiner engen Mitarbeiter. Im Jahr 1928 wurde er auf die Kathedra von Odessa berufen. Hier wurde er von einer neuen Welle der Repressionen gegen die Kirche erfasst, die die Bolschewiki 1929 begannen.
Im ganzen Land, auch in der Diözese Odessa, wurden Kirchen geschlossen, Priester verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Bis 1931 waren nur noch wenige Geistliche in Odessa auf freiem Fuß, der Rest wurde erschossen oder inhaftiert. Die Verklärungskathedrale, die militärische St.-Sergij-Kathedrale, die St.-Nikolaus-Kirche am Hafen und viele andere Kirchen in Odessa wurden gesprengt. Die meisten anderen wurden in Lagerhäuser umgewandelt oder für andere Zwecke verwendet.
Es gibt Hinweise darauf, dass Vladyka Anatolij, der inzwischen Metropolit geworden war, 1934 oder 1935 in diesem Umfeld seine Meinung über den Fehler der Kirchenpolitik von Metropolit Sergij geäußert hat, aber es ist nicht möglich, diese Hinweise zu bestätigen oder zu dementieren. Zu dieser Zeit wurde Vladyka selbst oft zum Verhör vorgeladen, auch nachts, wobei man ihn bedrohte und starken psychologischen Druck ausübte. Er ertrug das alles geduldig und setzte sich sogar für die Freilassung verhafteter Geistlicher ein, was zu jener Zeit sehr gefährlich war.
Augenzeugen zufolge führte Metropolit Anatoly ein sehr bescheidenes und sogar ärmliches Leben und ging zu Fuß zu den Gottesdiensten und zu seinen Terminen. Er war sehr gütig und sanftmütig, immer ruhig. Sein Hauptmerkmal war jedoch die Konzentration auf das Gebet, in dem er fast ständig verharrte.
Seine letzte Verhaftung und sein Martyrium
Im Jahr 1936 hatten die Behörden fast alle Kirchen in Odessa geschlossen. Vladyka diente in der St. Demetrius-Kirche, der einzigen noch funktionierenden Kirche. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1936 wurde er verhaftet und sofort nach Kiew gebracht. Dort war er sechs Monate lang unter sehr schwierigen Bedingungen inhaftiert und wurde dann nach Moskau geschickt. Interessanterweise lautete eine der Anklagen gegen ihn, dass er angeblich Kontakte zu Vertretern der katholischen Kirche hatte und mit ihnen über den Übertritt zum Katholizismus sowie über antisowjetische Agitation verhandelte. Vladyka Anatolij wies diese Anschuldigung kategorisch zurück und erklärte, dass er fest am orthodoxen Glauben festhalte, nirgendwo konvertieren wolle und mit keinen katholischen Persönlichkeiten in Kontakt gekommen sei.
Das Urteil, das die NKWD-Troika im Januar 1937 gegen ihn verhängte, war auf den ersten Blick milde: „nur“ fünf Jahre Lagerhaft. Damals waren die Troikas bei der Verhängung von Todesurteilen nicht zimperlich. Im Fall des Metropoliten Anatolij waren fünf Jahre Lagerhaft jedoch gleichbedeutend mit dem Tod, und zwar einem schmerzhaften Tod. Der Grund dafür war sein Gesundheitszustand, der sich während der Gefangenschaft erheblich verschlechtert hatte. Er litt an einem vernachlässigten Magengeschwür, das sich im Gefängnis stark verschlimmerte, und konnte auch seine Beine praktisch nicht mehr benutzen. Trotzdem wurde er in einem Konvoi nach Norden in die Republik Komi gebracht.
Einen Teil des Weges mussten die Gefangenen zu Fuß zurücklegen. Der kranke und erschöpfte Metropolit Anatolij konnte kaum gehen und fiel oft hin, woraufhin die Wachen ihn mit Gewehrkolben antrieben. Und wenn er das Bewusstsein verlor, ließen sie ihn eine Zeit lang auf dem Rücksitz eines Lastwagens mitfahren, um ihn dann zu Fuß zurückzutreiben. In der Kyltovsker Landwirtschaftskolonie wurde er zur allgemeinen Arbeit eingeteilt, erkrankte aber bald an einer kruppigen Lungenentzündung und verlor fast sein Augenlicht. Aus der Beschreibung der Lagerbehörden: „Er verrichtet 62 Prozent der Arbeit. Aufgrund seines hohen Alters arbeitet er nur noch schwach, aber er bemüht sich“.
Anfang 1938 wurde er in das Lagerkrankenhaus eingeliefert, wo er am 23. Januar starb. Kurz vor seinem Tod wurde ihm das Evangelium aus den Händen gerissen, aber das Kreuz konnte nicht herausgerissen werden. Vladyka starb mit dem Kreuz in der Hand.
Nachwort
Sein Lebensweg lehrt uns, allen Lebensumständen mit Demut und völliger Hingabe an den Willen Gottes zu begegnen. Niemals, unter keinen Umständen, von der Kirche abzuweichen und keine Kompromisse mit unserem Gewissen zu machen. Und auch gottgegebene Talente zu offenbaren, sei es in der Wissenschaft, der Bildung oder der Organisation von Hilfe für Kriegsopfer.
Es ist symbolisch und sehr passend, dass wir in der Schar der heiligen Neumärtyrer und Bekenner sowohl die Anhänger von Metropolit Sergij (Stragorodskij) als auch die Kritiker seiner Kirchenpolitik verherrlichen. Dies zeigt, dass die Kirche Christi trotz der bestehenden Unterschiede geeint ist und dass sie durch ihre Treue zu Christus, seinen Geboten und der Lehre der Kirche geeint ist.
O heiliger Hieromärtyrer Anatolij, bete zu Gott für uns.