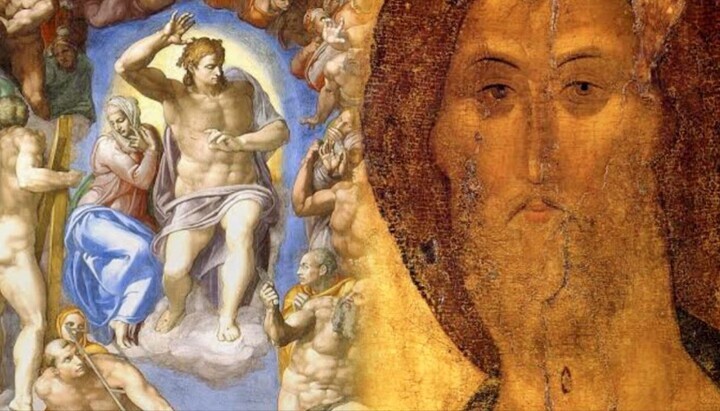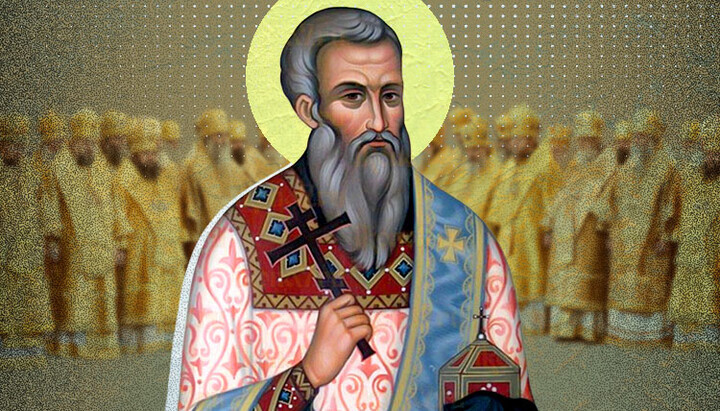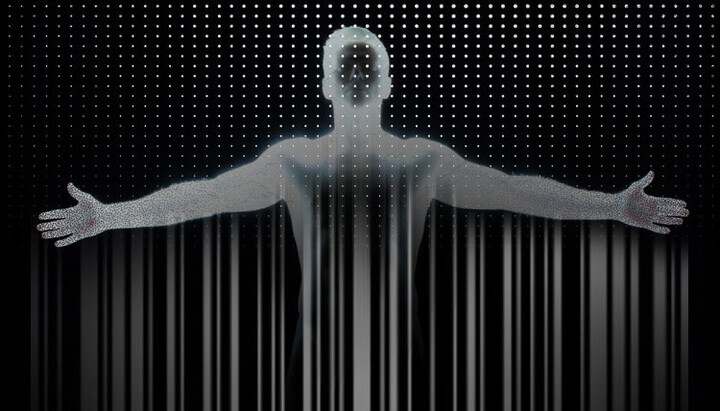Polygamie und Blutsverwandtschaftsehen: Warum gab es das bei den Patriarchen des Alten Testaments?
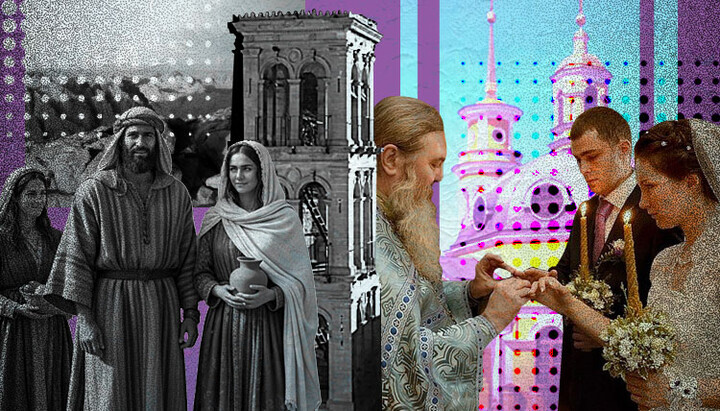
Beschäftigen wir uns mit komplexen Fragen des Alten Testaments: Warum hatten Abraham, Jakob und andere Urväter Ehen, die später durch die Gesetzgebung am Sinai verboten wurden?
Die Ehe wurde von Gott bereits im Paradies eingeführt, aber nach dem Sündenfall geriet diese Institution stark ins Wanken. Und zwar nicht nur bei den Heiden, sondern auch beim auserwählten Volk Gottes. Bei den alten Juden beispielsweise waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Ehen zwischen Personen, die eng miteinander verwandt waren, sowie Polygamie (Mehrehe) erlaubt.
Aus der Bibel wissen wir, dass solche Ehen sogar bei den heiligen Urvätern Abraham, Jakob, König David und König Salomon vorkamen.
Im Licht des Neuen Testaments erklären wir dies mit den Worten Christi über die „Hartherzigkeit” der Menschen (Mt 19,8), denn Gottes ursprünglicher Plan sah eine monogame Ehe vor: „Die zwei werden ein Fleisch sein” (Gen 2,24) – genau zwei, nicht drei oder mehr.
Die Bibel erwähnt auch die zahlreichen Probleme, zu denen die Polygamie führt. Später regelte das Gesetz Mose die ehelichen Beziehungen und schränkte die Willkür in diesem Bereich ein.
Historischer Kontext rund um Ehen mit engen Verwandten
Zu Beginn der biblischen Geschichte bestand die Menschheit aus einer einzigen Familie: Adam und Eva. Um Gottes Gebot „Seid fruchtbar und vermehrt euch“ (Gen 1,28) zu erfüllen, gingen ihre Nachkommen Ehen mit nahen Verwandten ein. So heiratete beispielsweise Kain, der Sohn Adams, eine Frau, die offenbar seine Schwester war (Gen 4,17). Nach der Sintflut befand sich die Familie Noahs in einer ähnlichen Situation: Seine Söhne und ihre Frauen wurden zu Stammvätern und Stammmüttern neuer Generationen (Gen 9,18–19). Solche Ehen galten nicht als unmoralisch, da sie in Abwesenheit anderer Menschen die einzige Möglichkeit darstellten, die Familie fortzuführen.
Diese Praxis blieb auch im patriarchalischen Zeitalter bestehen. Abraham heiratete seine Halbschwester Sara (Gen 20,12), und Isaak nahm Rebekka, seine Cousine, zur Frau (Gen 24,15). Jakob heiratete seine Cousinen Lea und Rahel (Gen 29,16–30).
Diese Verbindungen entsprachen nicht nur den Bräuchen der damaligen Zeit, sondern waren auch notwendig, um den Glauben und die Reinheit der Familie in einer heidnischen Umgebung zu bewahren.
Die Bibel verurteilt diese Ehen aus mehreren Gründen nicht. Erstens gab es vor dem Gesetz des Mose kein direktes göttliches Verbot solcher Verbindungen. Zweitens waren in den alten Kulturen des Nahen Ostens – Ägypten, Mesopotamien – Ehen innerhalb der Familie weit verbreitet, um die Stammesbindungen zu stärken und den Besitz zu erhalten. In diesem Zusammenhang waren die Ehen der Patriarchen nichts Außergewöhnliches.
Polygamie und ihre Folgen
Polygame Ehen waren ebenfalls weit verbreitet. Abraham hatte neben seiner Frau Sara die Konkubine Hagar (Gen 16,3–4), und Jakob, der zwei Schwestern, Lea und Rahel, geheiratet hatte, zeugte auch Kinder mit ihren Mägden (Gen 30,4–13).
Die Heiligen Väter, beispielsweise Johannes Chrysostomos, verstehen die Polygamie jener Zeit als ein vorübergehendes Phänomen, das Gott in seiner Nachsicht gegenüber der menschlichen Schwäche nach dem Sündenfall zugelassen hat, um die Menschheit zu erhalten und zu vermehren und um ihr allmähliches geistliches Wachstum zu fördern.
Dabei verschweigt die Bibel nicht die mit der Polygamie verbundenen Probleme: die Rivalität zwischen Sara und Hagar, die Eifersucht zwischen Lea und Rahel, die Feindschaft zwischen ihren Kindern – all dies führte zu schweren Konflikten innerhalb der Familie.
Leviratsehe
Selbst mit dem Aufkommen des Gesetzes unterschieden sich einige seiner Bestimmungen erheblich von den heutigen Vorstellungen. Eine davon war die Leviratsehe: Wenn ein Mann kinderlos starb, musste sein Bruder (oder ein anderer naher Verwandter) seine Frau heiraten, um dem Verstorbenen „Nachkommen zu verschaffen”. Das erste Kind, das aus einer solchen Ehe hervorging, galt als Nachkomme des Verstorbenen (5. Mose 25,5–6). Dieser Brauch war durch die Notwendigkeit bedingt, die Familie fortzuführen und den Landbesitz innerhalb eines Stammes zu erhalten.
Vom Alten Testament zum Neuen Testament
Die Heiratspraktiken der patriarchalischen Epoche waren durch historische Realitäten bedingt.
Mit der Verabschiedung der Gesetzgebung am Sinai (Lev. 18: 6–18) wurden strenge Verbote für enge Verwandtschaftsbindungen eingeführt.
Auch Ehen mit Fremden, d.h. fremder Volksstämme – Anm., wurden verboten, um den Glauben des auserwählten Volkes vor heidnischen Einflüssen zu schützen. Die Geschichte Israels zeigt, dass Ehen mit Heiden oft zum Abfall vom Glauben führten (3. Könige 11: 1–8).
Das Gesetz Mose war ein wichtiger Schritt zur Regulierung der ehelichen Beziehungen. Obwohl seine Normen noch weit von den Idealen des Neuen Testaments entfernt waren, bereitete es den Boden dafür.
Die auf Treue, Liebe und strenger Monogamie basierenden christlichen Regeln für das Eheleben verdrängten nach und nach die alten patriarchalischen Bräuche. Die Ehe wurde nun als geistliche Vereinigung zweier gleichberechtigter Personen verstanden, die die aufopfernde Liebe Christi und der Kirche widerspiegelt.