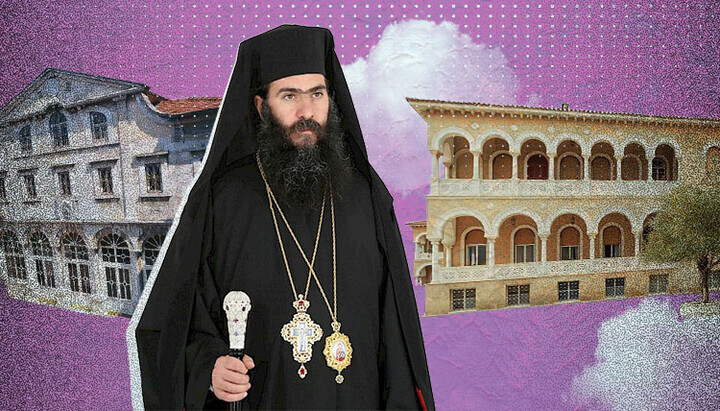Die Einheit der Orthodoxie in Gefahr: Ursachen und Lösungen.

Bericht von Bischof Hiob (Bandmann) von Stuttgart auf der 42. Orthodoxen Konferenz
Die Redaktion der Union Orthodoxer Journalisten in Deutschland veröffentlicht ausschließlich mit dem Segen von Bischof Hiob von Stuttgart seinen Vortrag auf der orthodoxen Konferenz, die Ende Dezember 2024 in München stattfand und von Metropolit Mark von Berlin und ganz Deutschland gesegnet wurde. Diese Konferenz findet bereits seit über 40 Jahren regelmäßig statt.
Bischof Hiob hält einen Vortrag auf der orthodoxen Konferenz in München. Screenshot von der Live-Übertragung auf dem YouTube-Kanal „Der Bote“.
Die Einheit der Orthodoxie in Gefahr: Ursachen und Lösungen.
Wer in diesen Tagen nicht die dunklen Schwaden der Bedrückung und tiefen Sorge wahrnimmt, die über den orthodoxen Kirchen hängen, dürfte entweder von ungewollter oder von gewollter Blindheit geschlagen sein. Die Einheit der Orthodoxie ist in großer Gefahr und es scheint so, als sähe niemand von den Verantwortlichen einen Ausweg aus dieser festgefahrenen Lage.
Lösungsansätze für diese ekklesiologische und sogar dogmatisch-triadologische Krise unserer Tage aufzuzeigen, ist daher kein leichtes Unterfangen. Auf der gebetsgestützten Suche nach Antworten ist der Autor auf folgende Apostellesung gestoßen, von der er sich bei seiner Arbeit inspirieren und leiten ließ:
Eph. 4,1 Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, 2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens: 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. 5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. 7 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden.
Bevor wir diese Verse des Apostels Paulus als Antwort auf die kirchliche Krise unserer Zeit auszulegen versuchen werden, gilt es, das Problem zu erfassen, welches dem gegenwärtigen traurigen Zustand der Kirche Christi zugrunde liegt.
1. Was lehrt uns die Kirchengeschichte?
Zunächst möchten wir untersuchen, was die Kirche in Krisen, wie der heutigen, in der Vergangenheit vor einer Spaltung bewahrt hat. Grundlegend für die Struktur und das Selbstverständnis der orthodoxen Kirche ist die Zeit der Ökumenischen Konzile. Geriet die Einheit der Kirche durch innere dogmatische Konflikte in Gefahr, wurde eine „Allgemeine“ oder „Große Synode“ einberufen, die als höchste kirchliche Instanz für die Formulierung dogmatischer Wahrheiten und Kanones gelten kann. In der Theorie ging es bei dieser Zusammenkunft (potentiell) aller Bischöfe der Weltkirche nicht darum, Kompromisse oder neue Lösungen zu finden, sondern unter dem Beistand des Heiligen Geistes ein einstimmiges Zeugnis abzulegen für den überlieferten rechten Glauben. Betrachtet man jedoch die historischen und politischen Zusammenhänge der Synoden, kommt man leicht in die Versuchung, sie als Instrumente z.T. profaner Interessenkonflikte misszuverstehen.
Nehmen wir zum Beispiel das Konzil von Nizäa 325 n. Chr.. Eusebios von Cäsarea schildert als einer der ersten Kirchengeschichtsschreiber diese Zusammenkunft der Bischöfe, die zum Präzedenzfall für alle folgenden Ökumenischen Synoden werden sollte, ausführlich und lebendig. Aus seinem Bericht wird u.a. deutlich, dass dem hl. Kaiser Konstantin sowohl im Vorfeld des Konzils, als auch während der Sitzungen die zentrale Rolle zukam, die zerstrittenen und verfeindeten Bischöfe zur Einheit zu führen – einer Einheit und Einigkeit, die zuallererst im Interesse des römischen Kaisers zu sein schien. Nachdem dieser nämlich ein Jahr zuvor (324) das Römische Reich endgültig unter sich vereint hatte, waren die dogmatischen Streitigkeiten und Gebietskonflikte der Bischöfe für ihn unnötige Stolpersteine auf dem Weg zu einem politisch wie religiös geeinten Reich. Indes schienen sich die Fronten der streitenden kirchlichen Akteure verhärtet zu haben. In der Vita Constantini gibt Eusebius von Cäsarea die Eröffnungsrede des Kaisers wieder und schreibt anschließend:
Nachdem der Kaiser also in lateinischer Sprache gesprochen und ein anderer seine Worte verdolmetscht hatte, gab er den Vorsitzenden der Synode das Wort. Da begannen die einen die anderen anzuklagen, diese aber verteidigten sich und erhoben Gegenbeschuldigungen. Als nun so von beiden Seiten sehr viel vorgebracht wurde und anfänglich ein großer Streit tobte, hörte der Kaiser langmütig allen zu und nahm mit gespannter Aufmerksamkeit das Vorgebrachte entgegen, und indem er sich in einzelnen Punkten für das aussprach, was von einer jeden Partei gesagt wurde, brachte er allmählich die streitsüchtigen Gemüter einander näher. Und weil er sich in ruhiger Milde an die einzelnen wandte und sich dabei der griechischen Sprache bediente, die ihm auch nicht unbekannt war, erschien er freundlich und gefällig; so konnte er die einen überzeugen, andere durch seine Worte beschämen, die, welche trefflich redeten, loben, alle aber zur Eintracht anfeuern, bis er es schließlich erreichte, dass sie über alle strittigen Punkte eines Sinnes und einer Meinung waren.
Dem Kaiser kam es zu, zum Konzil einzuladen, seine kaiserliche Post für die Reisen der Bischöfe einzusetzen, seinen Palast in Nizäa zur Verfügung zu stellen, auf den Sitzungen als Schlichter und Vermittler aufzutreten und zuletzt das Urteil gegen die Häretiker mit den Mitteln der Staatsgewalt durchzusetzen, damit in der Kirche die Einheit triumphieren konnte. Es drängt sich der Eindruck auf, dass das Glaubenszeugnis von Nizäa ohne die Vermittlung des Kaisers nie zustande gekommen wäre.
Betrachtet man in diesem Geiste die weitere Kirchengeschichte, so stellt man fest, dass auch das 2. Ökumenische Konzil (Konstantinopel 381 n.Chr.) die arianischen Wirren nicht allein beendete, sondern dessen Erfolg auf dem Edikt von Kaiser Theodosios beruhte, welches den orthodoxen Glauben zuvor als Staatsräson verkündet hatte. Das 3. Ökumenische Konzil (Ephesus 431 n.Chr.) endete in einem Zerwürfnis zwischen den Bischöfen Kyrill von Alexandrien und Johannes von Antiochien, so dass wiederum der Kaiser intervenieren musste: er ließ die beiden Streithähne inhaftieren und zwang sie so dazu, sich zu einigen, so dass der spätere Schriftwechsel der beiden Patriarchen schließlich von gutem Willen getragen war und das Konzil im Nachhinein doch noch ein Erfolg wurde.
Umgekehrt hat das spätere Fehlen einer alle Patriarchate umspannenden politischen Macht die großen Spaltungen der Kirchengeschichte begünstigt oder sogar bedingt. Die von den Vätern des 4. Ökumenischen Konzils formulierte christologische Glaubensformel, die zwischen der alexandrinischen und der antiochenischen Theologie zu vermitteln suchte, konnte die sog. altorientalischen Kirchen nicht dauerhaft davon abhalten, sich langsam politisch und kirchlich vom Kaiserreich abzuwenden. Spätestens als Ägypten und Syrien nicht mehr unter römisch-byzantinischer Herrschaft standen, setzten sich die Monophysiten als Volkskirche durch. Dabei möchte man nicht etwa nur die abweichende Theologie für die politische Entfremdung verantwortlich machen, vielmehr führte die politische Abkehr von der römischen Staatsidee in diesen Gebieten dazu, dass die dortigen Kirchenvertreter nach theologischen Scheidungsgründen mit der Reichskirche suchten. Schließlich könnte man auch leicht die politisch-historischen Gründe aufzeigen, die für das schleichende Schisma zwischen Ost und West mitverantwortlich waren.
Je länger wir das Thema also aus historischer Perspektive betrachten, desto mehr erhärtet sich der problematische Eindruck, dass die Einheit der Kirche ohne eine übergeordnete politische Macht nicht zu halten ist.
2. Ein schrecklicher Verdacht
Dieser Blick auf die Kirchengeschichte führt unweigerlich zur folgenden Frage: „Wer oder was kann uns heute wieder zusammenbringen, ohne dass wir über ein Äquivalent zum Kaiser der Rhomäer oder zur „Pax Romana“ verfügen?“ Diese Frage gewinnt an Aktualität, wenn man sich die gegenwärtige Patsituation anschaut, in der sich die Orthodoxie befindet: Dasselbe Patriarchat, welches in den meisten Problemen und Konflikten selbst involviert und parteiisch ist (Kalenderfrage, Autokephalie-Frage, Diaspora-Frage, Primats-Frage), beansprucht für sich zugleich das alleinige Recht, eine Allgemeines Konzil einzuberufen und ihm vorzusitzen.
Die oben genannte Frage hat sich der Autor nicht nur selbst gestellt, sondern auch einigen kirchlichen Würdenträgern und Theologen in der Hoffnung, dass irgend jemand den schrecklichen Verdacht zerstreuen kann, die Einheit der Kirche könne tatsächlich scheitern, der aus einem Stück gewebte Rock Christi könne doch zerreißen.
Zwei bemerkenswerte Antworten möchte der Autor hier exemplarisch anführen. Auf einer Reise zum Heiligen Berg Athos stellte der Autor seine Frage u.a. dem Abt eines der Athosklöster, einem Vertreter des Ökumenischen Patriarchats. Seine erschreckende Antwort lautete: „Die beiden Patriarchen müssen erst sterben“, wobei er die Patriarchen Bartholomäos von Konstantinopel und Kyrill von Moskau meinte. Eine neue Generation von Hierarchen könnte ihm zufolge also einen Neuanfang der Beziehungen zwischen den beiden Patriarchaten einläuten.
Auf derselben Reise stellte der Autor seine Frage auch dem 2023 neu eingesetzten Metropoliten von Thessaloniki Filotheos. Seine Antwort war eine theologische: „Der Heilige Geist wird uns wieder zusammenbringen.“
Angesichts der oben beschriebenen eher ernüchternden Beispiele aus der Kirchengeschichte stimmten beide Antworten den Autor skeptisch. Beide Geistlichen sehen offenbar keine grundlegende Gefahr für die Einheit der Kirche, sondern nur zeitlich begrenzte Krisen, die sich von selbst, aus der inneren Kraft der orthodoxen Einheit lösen lassen. Der Rückblick auf die großen Schismen in der Kirchengeschichte scheint dieser Sichtweise zu widersprechen. Die Ausweglosigkeit der gegenwärtigen Situation, in der auch ein Ökumenisches Konzil kein gangbarer Lösungsansatz zu sein scheint, bestätigt scheinbar das Gegenteil: Die Einheit kann scheitern, Kirchen können sich abspalten.
3. Was hält die Kirche eigentlich zusammen?
Vor diesem Hintergrund müssen wir einen Schritt tiefer gehen und die Frage stellen, was die Kirche überhaupt zusammenhält, bzw. worin ihre innere Einheit besteht. Wir sprechen von einer mystischen Einheit, vom Leib Christi, der vom Hl. Geist zusammengehalten wird und in der Eucharistie und im orthodoxen Glauben vereint ist. Wir möchten unser Augenmerk jedoch auf konkrete Phänomene und Kräfte lenken, die die Einheit der Kirche fördern, sichern, aber auch untergraben und brechen können. Gerade in diesen Punkten ist die Mitwirkung des Menschen an der Einheit möglich und auch nötig.
Autorität. In der Kirche sorgt eine hierarchische Struktur, basierend auf der Apostolischen Sukzession, für eine auf Würde, Respekt, Autorität, hierarchischer Ordnung, Brüderlichkeit und leider oft auch auf Macht gründende Einheit. Diese Macht soll jedoch zugleich als Dienst (griech. diakonia) verstanden und ausgeübt werden („Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein“ – Mk 9,35). Der Primus inter pares, der „Erste unter Gleichen“ (seit dem Wegfall Roms von der Gesamtorthodoxie ist das der Patriarch von Konstantinopel) sitzt der Gesamtorthodoxie vor und hat die oberste Aufgabe, die Einheit der Orthodoxie zu wahren und zu symbolisieren.
Identität. Gemeinsamer Glaube schafft eine Zugehörigkeit, die Kirche eine Identität. Der Leib Christi, dessen Teil wir sind, verleiht dieser christlichen Identität eine einzigartige ontologische Realität.
Gemeinschaft. Wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, freundschaftliche Beziehungen pflegen und so Gemeinschaft leben, dann eint uns das. Auch hier geht die kirchliche Gemeinschaft weit über das Zwischenmenschliche hinaus, sie führt zur Gemeinschaft mit den Heiligen aller Zeitalter, mit der Sphäre des Heiligen und mit dem transzendenten Gott selbst.
Politik. Gemeinsame politische Interessen oder Ideen können uns vereinen. Rom war für viele orthodoxe Völker lange Zeit eine solche vereinende politische Idee und Realität. Politik kann aber auch spalten.
Dass der Glaube im Heiligen Geist die Kirche eint und der mystische Leib Christi besonders im Mysterium der Eucharistie konstituiert wird, ist sicherlich richtig. Sich aber darauf zu verlassen, dass der Heilige Geist allein uns schon zusammenhalten wird, scheint mir zu kurz gedacht, ja fahrlässig zu sein. Autorität, Identität, Gemeinschaft und (Kirchen-)Politik müssen aktiv gepflegt werden, um die Einheit zu bewahren.
Eine Einheit, die alle diese Aspekte berücksichtigt, möchte ich unter dem Begriff „gelebte Synodalität“ präsentieren und als Lösung unserer gegenwärtigen Krise anbieten.
4. Gelebte Synodalität
Gelebte Synodalität bzw. der Mangel an ihr ist m.E. genau das, was uns derzeit am meisten zu schaffen macht. Sie beinhaltet, wie gesagt, alle oben genannten Aspekte. Es gibt keine Synodalität ohne Autorität und Primat. Es gibt keine Synodalität ohne Identität, ohne gemeinsamen Glauben, ohne eine gepflegte Gemeinschaft, gemeinsame Liturgie. In der alten Kirche wird schon früh und mit kirchenrechtlicher Verbindlichkeit verlangt, dass sich die Bischöfe regelmäßig versammeln und wichtige Fragen gemeinsam lösen.
Zweimal im Jahre soll eine Synode der Bischöfe stattfinden. (In diesen Synoden) sollen die Bischöfe untereinander die Grundsätze des Glaubens überprüfen und die auftauchenden kirchlichen Streitigkeiten beilegen […]. – Kanon 37 der Apostel
Diese Regel, die auf dem 1., 4., 6, und 7. Ökumenischen Konzil wiederholt wird, gilt mit unterschiedlichen Intervallen grundsätzlich für jede synodal verfasste Kirchenstruktur. Dass diese Forderung in den Kanones so oft wiederholt wird, zeigt zum einen, dass es zu allen Zeiten auch entgegengesetzte Kräfte gab. So neigen Bischöfe, aber auch Priester, oft dazu, sich in ihren Diözesen bzw. Gemeinden abzuschotten und die Dinge nach eigenem Gutdünken zu regeln, anstatt sich dem weisen Rat, aber auch dem kritischen Blick der Nachbarn / Kollegen zu öffnen. Der Nachdruck der Wiederholung zeigt darüber hinaus, wie wichtig es ist, sich zu versammeln und Probleme gemeinsam zu lösen, Missverständnisse durch Kommunikation aus dem Weg zu räumen und so Gemeinschaft und Identität zu pflegen.
Hierbei darf auch die Frage nach dem Primat nicht außer Acht gelassen werden. Wer versammelt Synoden und wer verantwortet die Einheit? Schon Kanon 34 der Apostel hat eine spezifische Lösung für das überaus schwierige und paradoxe Wechselverhältnis zwischen Primat und Synodalität, zwischen Autorität und Freiheit gefunden, die auf lokalkirchlicher, aber in ihrer Grundintention auch auf panorthodoxer Ebene anwendbar ist. Sie sollte auch auf die aktuelle Fehlinterpretation des gesamtkirchlichen Primats durch manche Vertreter des Ökumenischen Patriarchats als Antwort dienen:
Die Bischöfe jedes Volkes sollen wissen, dass einer von ihnen der Erste (Primus) sein müsse, und sollen ihn als ihr Haupt ansehen und weiter nichts ohne seine Zustimmung tun; nur das allein soll jeder tun, was auf seine eigene Gemeinde und die ihr untergeordneten Orte Bezug hat. Aber auch jener (der Primus, der Metropolit) darf nichts ohne die Zustimmung aller tun; denn so wird Eintracht herrschen und Gott verherrlicht werden durch Christus im Heiligen Geist.
Diese Ordnung, in der kein Bischof etwas ohne die Zustimmung des Ersten und der Erste nichts ohne die Zustimmung aller tut, löst jene Spannung, jenen Kontrast zwischen der Macht eines Einzelnen über alle und der Autorität aller zusammen sowie der Souveränität jedes Einzelnen hin zu einer echten Einheit in Eintracht und gelebter Synodalität auf.
Synodalität sollte auch auf gesamtkirchlicher bzw. panorthodoxer Ebene herrschen, wo das Prinzip der Autokephalie jeder Lokalkirche eine weitestgehende Selbstständigkeit garantiert und es kein institutionelles bzw. regelmäßiges Entscheidungsorgan gibt, dem das Ehrenoberhaupt (primus inter pares) der Orthodoxie vorsitzen würde. Es ist jedoch nicht etwa so, wie der russische Theologe N. N. Afanassjew († 1966 in Paris) in seinem kontroversen Artikel über den Primat des Petrus geschrieben hat, dass die Orthodoxe Kirche wie eine „Pyramide ohne Spitze“ scheint, es ihr also im Gegensatz zur röm.-kath. Kirche an einem echten Oberhaupt, ausgestattet mit entsprechender Macht, ermangelt. Gleichzeitig widerspricht diese Ordnung den Theologumena eines Metropoliten Ioannis Zizioulas, der die „Monarchie des Vaters“ als Urgrund, der den anderen Hypostasen das Sein verleiht, zum Vorbild für den Primat in der orthodoxen Kirche zu erklären versucht, denn die Autorität des Primus ist nicht die Quelle für die Autorität der anderen Bischöfe (wie in der katholischen Papstlehre), sondern erwächst, wie der Kanon zeigt, umgekehrt aus seiner Anerkennung als „Haupt“ („als ihr Haupt ansehen“) durch das Konzil und auf oberster Ebene durch die Festlegung der Diptychen der Autokephalen Kirchen auf den Ökumenischen Konzilen. Der Primat ist auch nicht eine ewige göttliche Fügung, sondern politisch-historisch herzuleiten.
Wie es die Autoren des 34-sten Kanons der Apostel beschrieben haben, kann die Kirche die Gegensätze vereinen: Eine konziliare Gemeinschaft und eine hierarchische Pyramide sein. Sie bedarf außer ihres wahren Oberhaupts, Christus, keines Alleinherrschers, auch keines Stellvertreters (vicarius Christi), denn Christus ist ja in seinem Leib anwesend.
Das Ideal der „gelebten Synodalität“ beschränkt sich jedoch nicht auf die bischöfliche Konziliarität. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben v.a. russische Theologen, wie z.B. A. S. Chomjakow, die bedeutende Rolle des mündigen Gottesvolkes bei der Verteidigung des Glaubens, der Akkreditierung der Ökumenischen Synoden und der Bewahrung der Einheit herausgearbeitet, die nicht erst seit dieser theologischen Anerkennung das Selbstbewusstsein der orthodoxen Kirche prägt. Beispielsweise erklärt Metropolit Filaret (Drosdow) von Moskau in seinem Großen Katechismus:
«Все верующие, объединенные священным Преданием веры, все вместе и в наследовании, созидаются Богом в единую Церковь, которая и есть истинная сокровищница священного Предания, или, выражаясь словами ап. Павла, «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины».
„Alle Gläubigen, die durch die heilige Überlieferung im Glauben vereint wurden, werden alle zusammen und über die Generationen hinweg von Gott zu einer Kirche erbaut. Sie ist der wahre Hort der heiligen Überlieferung, oder mit den Worten des Apostels Paulus, „die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und Befestigung der Wahrheit“.
Praktisch drückt sich die Verantwortung des „Gottesvolkes“ darin aus, die synodalen Entscheidungen der Bischöfe zu rezipieren oder gegen Konzile, die keine waren, oder Bischöfe, die gegen das Evangelium handeln, zu protestieren. Auch dem Mönchtum kommt diese Rolle als Korrektiv zur bischöflichen Autorität mit zu. In den modernen Statuten z.B. der Russischen und der Rumänischen Kirche findet die Anerkennung der Mündigkeit des Gottesvolkes seinen konkreten Ausdruck in der Beteiligung von Laien am Landeskonzil.
Gelebte Synodalität vereint also Autorität, Identität und Gemeinschaft zu einem organischen Gefüge, fördert alle drei einheitsstiftenden Prinzipien und durchdringt sie mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche. Eine Hierarchie wurde aus historisch-politischen Gründen herausgebildet. Die kirchliche Struktur folgt – oft mit großer Verzögerung – den politischen Realitäten. Die Autorität dieser Hierarchie, sei es auf lokalkirchlicher, sei es auf panorthodoxer Ebene, gründet jeweils auf der synodalen Beauftragung und dem Vertrauen des gläubigen Volkes.
Bleibt noch die Politik – das Gebiet, das die Kirchen selbst am wenigsten beeinflussen können. Eine Lokalkirche kann zwar politisch instrumentalisiertem Hass und Separatismus grundsätzlich entgegenwirken, sie kann aber die großen geopolitischen Verwerfungen, das Auseinanderbrechen von Vielvölkerstaaten und kulturellen Räumen oder das Entstehen von neuen Nationen nicht verhindern.
5. Ist der politische Faktor an allem schuld?
Im Konflikt zwischen den Patriarchaten von Konstantinopel und Moskau wirken politische Faktoren gegen die Einheit, und das nicht erst seit heute, sondern bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Russische Kirche durchlief in dieser Zeit drastische Veränderungen: zunächst befreite sie sich mühevoll aus der Bevormundung und Einhegung durch das Russische Imperium der Petrinischen Epoche und entwickelte in der Folge ihres kurzen Wiederaufblühens um die Jahrhundertwende eine weltweite Aktivität, die für die anderen Kirchen z.T. bedrohlich wirkte (riesige Athos-Klöster, Heilige Orte und Pilgerzentren in Palästina, Zaren-Kirchen in Westeuropa, Mission in Alaska, Mandschurei und Japan, nordamerikanische Diaspora etc.); es folgte ihre furchtbare Schicksalsstunde mit der Oktoberrevolution, dem Tod des Patriarchen Tichon und der Teilung in den kommunistischen Ostblock und die westlich geprägte Diaspora. In der Sowjetunion wurde der Episkopat des Moskauer Patriarchats später zum politischen Instrument des kommunistischen Regimes. Sowohl in Bezug auf die Ökumenische Bewegung, als auch in den interorthodoxen Beziehungen spielte die enge und unfreiwillige Abhängigkeit der Vertreter des MP von der Sowjetpolitik eine unrühmliche und schädliche Rolle. Auch heute kann man das MP wieder als patriotisch und loyal gegenüber dem Staat bezeichnen.
Das Ökumenische Patriarchat hat sich nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs politisch neu gen Westen ausgerichtet. Die Einführung des neuen Kalenders und eine ganze Serie von Einmischungen in Ortskirchen, die dem Moskauer Patriarchat unterstellt waren oder sind (die „Erneuerer“-Kirche in Russland, die Kirchen von Estland, Finnland, Polen, Lettland und Ukraine), spiegeln eine aktive Instrumentalisierung durch westliche Kräfte im Kalten Krieg und darüber hinaus bis heute wider, die hauptsächlich gegen Russland und die Russische Kirche gerichtet ist, letztlich aber der gesamten Kirche schaden. Der größte und mächtigste Bischofssitz des ÖP liegt vielleicht nicht in der Türkei, sondern ist die „Griechisch-Orthodoxe Erzdiözese von Amerika“.
Das Patriarchat hat sowohl im kleinasiatischen Kernland – der heutigen muslimischen Türkei – als auch historisch bedingt im autonomen Griechenland an Bedeutung verloren. Angesichts dessen drängt sich Eindruck auf, dass es auch eigene Interessen verfolgt, denn es befindet sich auf der Suche nach seiner Rolle unter den orthodoxen Kirchen, nach einer Existenzberechtigung als erstes Patriarchat. Dafür hat es in einer höchst umstrittenen Auslegung des Kanons 28 von Chalzedon seine Jurisdiktion über die gesamte orthodoxe Diaspora erklärt – ein Anspruch, den bislang nur die Griechische Kirche akzeptiert, indem sie auf eine eigene Diaspora-Struktur verzichtet hat.
Zudem konzentriert sich der Ökumenische Patriarch angesichts seines schwindenden pastoralen Auftrags zunehmend auf die weltliche Politik und seine Rolle als Ehrenprimus unter den orthodoxen Patriarchaten. Diese versucht er aufzuwerten, indem er sich mehr Macht zuschreibt, als es ihm im Kanon 34 der Apostel oder im Kanon 28 von Chalzedon, oder auch faktisch durch die anderen autokephalen Kirchen eingeräumt wird. So hat er bereits mehrmals für sich in Anspruch genommen, „ohne die Zustimmung aller“ orthodoxen Lokalkirchen die Autokephalie zu verleihen.
Das Appellationsrecht, welches dem Patriarchen seit dem Konzil von Chalzedon zustand, „weil Konstantinopel Reichshauptstadt ist“, wird systematisch überdehnt und missbraucht: Kleriker und Bischöfe, die in anderen orthodoxen Kirchen unter Zelebrationsverbot oder Laisierung gefallen sind, werden auf ihre Bitten einfach ins ÖP aufgenommen und so das Urteil gegen sie ohne neues Verfahren aufgehoben. Auch die Bemühungen des Patriarchen, in der Ökumenischen Bewegung ganz vorne dabei zu sein, zeugen von dem Selbstanspruch, mehr als nur der „primus inter pares“ zu sein. Rhetorische Querschüsse, wie die Stellungnahme von Erzbischof Elpidophoros von Nordamerika vom 7. Januar 2014 mit dem provokativen Titel „Erster ohne Gleichen“ (primus sine paribus) oder die Rede des Ökum. Patriarchen Bartholomäos selbst vom 1. September 2018 vor dem Bischofskollegium des ÖP, in der er Sätze gebraucht wie „Der Beginn der Orthodoxen Kirche ist das Ökumenische Patriarchat“, oder: „Die Orthodoxie kann nicht ohne das Ökumenische Patriarchat existieren“, sollen die theologische Legitimation dazu geben.
Wenn man die hoffnungslose Lage des Patriarchats in der Türkei und die damit verbundene Identitätskrise außer Acht ließe, könnte man meinen, die Phanarioten seien von „papistischer“ Machtgier getrieben. Jedoch meine ich, dass wir nur mit Verständnis und Wohlwollen dem ÖP, sowie der gesamten Orthodoxie aus ihrer Krise helfen können. Wenn wir vom Primus erwarten, dass er „nichts ohne die Zustimmung aller“ tut, dann sollten auch wir, die einzelnen orthodoxen Kirchen versuchen, „nichts ohne seine Zustimmung“ zu tun. Wir sollten zudem von ihm einfordern, seine Verantwortung für die Einheit der Orthodoxie wahrzunehmen und gangbare Lösungen für die gegenwärtigen Probleme vorzuschlagen und damit ihm die Initiative einräumen. Anstatt dem ÖP vorzuwerfen, sich zum Handlanger weltlicher Geopolitik gemacht zu haben, sollte z.B. auch das Moskauer Patriarchat sich eingestehen, dass es politisch voreingenommen handelt und sich instrumentalisieren lässt. In der Geschichte der Beziehungen der orthodoxen Kirchen im 20. Und 21. Jahrhundert, besonders zwischen dem MP und dem ÖP, können sich alle Seiten mit Recht Fehlverhalten vorwerfen. Schuldzuweisungen, auch wenn sie stimmen mögen, tragen jedoch nicht zur Lösung bei.
6. Die Mahnung des Apostels Paulus
Wenn wir so versuchen, hinter die profane Politik zu schauen, den anderen in seinen Interessen, Nöten und Ängsten ernst zu nehmen und die vereinigende Kraft der Kirche wahrzunehmen, gelangen wir zu der gelebten Synodalität, zu der auch der hl. Apostel Paulus uns im Epheserbrief aufruft:
… mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend.
Trotz Differenzen und Verletzungen der Kanones sollten wir nicht aufhören uns zu treffen, Freundschaften und belastbare Beziehungen aufbauen, verhandeln, Kompromisse finden und über die menschlichen Unzulänglichkeiten einzelner Akteure hinwegsehen.
… Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens.
Synodale Einheit zu leben, sich ihrer zu befleißigen, bedeutet auch für jede Lokalkirche regelmäßig Konzile abzuhalten, die dieser Bezeichnung würdig sind. Einige Kirchen neigen in jüngster Geschichte dazu, im Amt des Patriarchen zu viel Macht zu konzentrieren und die Kontrollfunktion des Konzils nicht ernst zu nehmen. Das Band des Friedens scheint mir hingegen jene Wechselwirkung zwischen Primus und Synode, aber auch zwischen den autokephalen Kirchen auszudrücken, die auf gegenseitiger Achtung und gemeinschaftlich wahrgenommener Verantwortung für den Leib Christi beruht. Ein „Band“ ist in der Lage, Belastungen auszuhalten, z.B. durch die Ziehkräfte der weltlichen Politik und der menschlichen Schwächen, so dass die Einheit der Kirche liturgisch (Leib) wie synodal-gemeinschaftlich (Geist) bestand hat:
… Ein Leib und ein Geist,
Darüber hinaus sollten die Kirchen die synodale Verantwortung und das „Charisma“ des mündigen Glaubensvolkes sowie des Mönchtums wieder mehr zur Geltung kommen lassen. Wenn es uns z.B. an einer weltlichen Macht mangelt, die die Kirchen zur Einheit drängt, kann dafür immer noch das Gottesvolk auf die Hierarchie Druck ausüben, die eitlen politischen Zänkereien aufzugeben und sich mit den Glaubensbrüdern der anderen orthodoxen Kirchen wieder zu einigen. Welche konkreten Möglichkeiten es dafür gibt, ist eine Frage für sich. Vorrausetzung ist jedoch sicherlich die Bereitschaft der Bischöfe zuzuhören, ihre Herde zu kennen und mit ihr zu leben.
… Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden.
Die Gnade, das Charisma jedes Einzelnen, mit der Stimme der Kirche zu sprechen, fußt in der mystischen Gemeinschaft des Kelches Christi, in der Teilhabe aller am selben Leib der Kirche. Dabei sollte eine lebendige Verbindung zwischen allen Gliedern / Stufen der hierarchischen Ordnung der Kirche in beide Richtungen und mit gegenseitiger Ehrfurcht vor dem Wirken der Gnade in jedem Einzelnen nach dem Maß der Gabe Christi herrschen. Die Rolle Christi und Seines Hl. Geistes synodal, eucharistisch und theologisch immer wieder neu zu entdecken, zu würdigen, zu leben, das bedeutet die gelebte Synodalität, das schafft die wahre Einheit des einen Leibes Christi.
… Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist.
Amen.