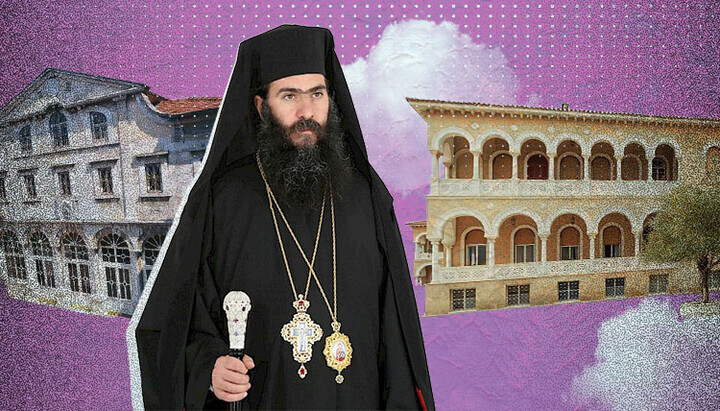Was hat die Synode der UOK in Theophanija gegeben und was nicht?

Vor drei Jahren proklamierte die Synode der UOK die vollständige Unabhängigkeit jener Kirche. Nun können einige Ergebnisse und Folgen ihrer Entscheidungen zusammengefasst werden.
Eine kurze Kirchengeschichte
Die Metropolis von Kiew wurde 988 nach Christus mit der Taufe der Rus gegründet. Organisatorisch handelte es sich um mehrere Eparchien, die zu einem Metropolitankreis vereint waren. Dieser wurde vom Metropoliten von Kiew geleitet und ist Teil der Kirche von Konstantinopel. Die Beziehungen zu Konstantinopel bestanden hauptsächlich darin, dass Konstantinopel in der Rus einen Metropoliten ernannte und die Rus großzügige Geschenke nach Konstantinopel schickte. Die Metropolis von Kiew wurde manchmal geteilt und dann wieder vereint. Dies geschieht aus politischen Gründen, wenn nach dem Niedergang Kiews zwei politische Zentren in der Rus entstehen: die Fürstentümer Galizien-Wolyn und Wladimir-Susdal. Alle Entscheidungen wurden in Konstantinopel getroffen.
Diese Ordnung bestand bis 1686, als die Kiewer Metropolis auf Beschluss des Patriarchats von Konstantinopel „für immer und ewig“ Teil des Moskauer Patriarchats wurde. Dies wurde de facto von allen damaligen Ortskirchen anerkannt, deren Vertreter ohne kanonische Einschränkungen mit den Hierarchen und dem Klerus der Russisch-Orthodoxen Kirche konzelebrierten. Nach 1918 und bis zum Ende der UdSSR existierte die Kirche in der Ukraine als Ukrainisches Exarchat des Moskauer Patriarchats.
1990 wurde sie zur autonomen Ukrainischen Orthodoxen Kirche. Tatsächlich ist sie in ihrer Leitung völlig unabhängig und autonom. Formal gibt es jedoch mehrere Punkte, die sie mit dem Moskauer Patriarchat verbinden:
- Die UOK ist durch die Russisch-Orthodoxe Kirche mit den Ortskirchen verbunden;
- ihr Primas wird vom Moskauer Patriarchen gesegnet;
- der Name des Moskauer Patriarchen wird in den Gottesdiensten verkündet;
- ihr Primas ist ständiges Mitglied der Synode der Russisch-Orthodoxen Kirche;
- Der Bischofsrat der UOK handelt auf Grundlage der Beschlüsse der Orts- und Bischofssynoden der ROK.
Gleichzeitig sind Fälle, in denen sich die ROK selbst im Rahmen der oben genannten Punkte in die inneren Angelegenheiten der UOK eingemischt hätte, kaum vorstellbar. Die Leitungsgremien der ROK haben die Beschlüsse der UOK nie aufgehoben, der Moskauer Patriarch hat das neu gewählte Oberhaupt der UOK stets gesegnet usw. Gleichzeitig wurde der kanonische Status der UOK als kirchliche Autonomie innerhalb der ROK definiert.
Um zu verdeutlichen, wie eng diese Bindungen und wie „abhängig“ die UOK ist, verweisen wir auf die Bestimmungen des Tomos und der Satzung der OKU über ihre Beziehungen zum Patriarchat von Konstantinopel. Es sei wohl angemerkt, dass die OKU offiziell als „autokephal“ erklärt wurde. Diese Bestimmungen lauten wie folgt:
- Die OKU ist durch das Patriarchat von Konstantinopel mit der Orthodoxie verbunden;
- Der Tomos des Patriarchats von Konstantinopel hat Vorrang über der Satzung der OKU;
- Fragen, die in der Satzung der OKU nicht geregelt sind, werden von der von Konstantinopel ernannten Kommission entschieden;
- Die OKU hat das Recht, Ukrainer nur innerhalb der Ukraine zu betreuen; außerhalb der Ukraine wird dies vom Patriarchat von Konstantinopel wahrgenommen;
- Die OKU ist verpflichtet, sich bei wichtigen Entscheidungen an den Phanar zu wenden, der diese Entscheidungen unabhängig trifft und der OKU bekannt gibt;
- Der Phanar verfügt über eine eigene Stavropegia (Strukturen) auf ukrainischem Gebiet;
- Die OKU erhält das heilige Myrrhon vom Patriarchat von Konstantinopel;
- Der Patriarch von Konstantinopel ist die letzte richterliche Autorität der OKU und kann daher alle Entscheidungen, die einen Geistlichen betreffen, aufheben.
Wie wir sehen, ist die Abhängigkeit der OKU vom Patriarchat von Konstantinopel viel stärker als die der UOK von der ROK im Jahr 1990, obwohl sich die OKU nicht als autonome, sondern als autokephale Kirche bezeichnet.
Als die Synode der UOK am 27. Mai 2022 in Theophanija getagt hat, war die UOK bereits praktisch in jeder Hinsicht unabhängig. Ihre Unabhängigkeit ging sogar über den Status der Autonomie hinaus. Die Verkündung der vollständigen Autokephalie wurde jedoch durch mehrere Faktoren erschwert, vor allem durch die folgenden:
· das Fehlen eines allgemein anerkannten Verfahrens zur Gewährung der Autokephalie und der Diskussion darüber in der Orthodoxie sowie
· das Fehlen einer einheitlichen Meinung unter den Hierarchen, Geistlichen und Kirchenleuten der UOK über die Notwendigkeit der Autokephalie.
Doch dann trat ein sehr wichtiger Faktor in Erscheinung – der Krieg.
Kurze kirchenpolitische Vorgeschichte
Leider vollstreckte die Kirche in der Rus oft den Willen der weltlichen Behörden bzw. widersprach ihnen zumindest nicht. Sie orientierte sich dabei an der Kirche von Konstantinopel, die historisch auf die Macht der Kaiser angewiesen war – zuerst der byzantinischen, später der osmanischen – und in den meisten Fällen deren Willen durchführte.
Dies zeigte sich besonders deutlich in jenem Teil der einst vereinten Metropolis Kiew, der im Fürstentum Wladimir-Susdal lag. Später verlagerte sich sein Zentrum nach Moskau, und schließlich entwickelte sich daraus die Russisch-Orthodoxe Kirche. Dies wurde maßgeblich dadurch erleichtert, dass der Moskauer Fürst und später auch Zar bzw. Kaiser orthodox waren. Jener Teil der Metropolis Kiew, der im Fürstentum Galizien-Wolyn lag und sein Zentrum in Kiew hatte, wurde schließlich Teil des vorwiegend römisch-katholischen Polen-Litauens.
Die Moskauer Metropolis (später Patriarchat) führten fast immer den Willen ihrer Zaren aus. Es ist schwierig, Beispiele für das Gegenteil zu finden, und diese sind nicht eindeutig. Selbst als beispielsweise der heilige Märtyrer Metropolit Philipp im 16. Jahrhundert Iwan den Schrecklichen kritisierte, setzten ihn seine übrigen Mitbischöfe im gehorsam an den Großfürsten ab und schickten ihn in ein Kloster.
Die Kiewer Metropolis hingegen haben historisch viel Erfahrung mit Ungehorsam gegenüber weltlichen Behörden unter für die Kirche ungünstigsten Bedingungen. Wir sprechen von der Union von Brest im Jahr 1596. Damals beschlossen die Behörden der polnisch-litauischen Union, dass sie die orthodoxe Kiewer Metropolis ohne großen Aufwand und auf Befehl dem Vatikan unterordnen könnten. Die Analogien zur heutigen Zeit sind verblüffend: Aktuell versuchen nämlich die ukrainischen Behörden ebenfalls, der Kirche Befehle zu erteilen, auf dass sie sich gehorsam dem Projekt der OKU anschließe. Doch damals – wie zumindest bis heute – zeigte die Kirche Ungehorsam. Im 17. Jahrhundert zog die ukrainische-orthodoxe Kirche (um ihr einen Namen zu geben) es vor, den Zorn der Machthaber zu ertragen und unterdrückt zu werden, anstatt die Orthodoxie und die Kanones der Kirche zu verraten.
Analysiert man die kirchenpolitischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte, so zeigt sich, dass sowohl die UOK als auch die ROK begannen, ihre Beziehungen zwischen Kirche und Staat entsprechend ihren historischen Erfahrungen zu gestalten. Besonders deutlich wurde dies ab etwa 2008. In diesem Jahr weigerte sich die UOK, den Forderungen der Juschtschenko-Administration nachzugeben und den Besuch des Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel in Kiew für die Gründung einer einheitlichen Nationalkirche zu nutzen. Gleichzeitig wurde in der ROK Metropolit Kirill als Nachfolger des verstorbenen Patriarchen Alexij gewählt, der die Beziehungen zwischen Kirche und Staat schrittweise auf eine qualitativ neue und deutlich engere Ebene brachte als sein Vorgänger.
Am 24. Februar 2022 begann die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, die die UOK und die ROK vor neue Herausforderungen stellte.
Die russische Kirche stand vor einer ganz bestimmten Entscheidung: zwischen der Lehre des Evangeliums und der Loyalität zum Staat. Und wenn diese beiden Dinge vor dem Krieg noch irgendwie vereinbar waren, so stand die Russisch-Orthodoxe Kirche mit dem Beginn des „SMO“ vor einem Dilemma.
Während des Krieges wurden Hunderte ukrainischer Städte und Dörfer zerstört. Zehntausende Menschen starben, und Millionen verloren ihre Heimat und Existenzgrundlage. Mehr als dreihundert Kirchen der UOK wurden teilweise oder vollständig zerstört. Man könnte meinen, ein Christ könne dies unter keinen Umständen als „göttliche Tat“ und „heiligen Krieg“ bezeichnen. Doch leider hat sich die russisch-orthodoxe Kirche dazu entschieden.
Natürlich haben die Leitungsgremien der russisch-orthodoxen Kirche keine offiziellen Dokumente zur Unterstützung des Angriffskrieges verabschiedet, und wahrscheinlich unterstützt ein erheblicher Teil ihrer Gläubigen diesen Krieg nicht. Doch die offizielle Rhetorik der Hierarchie der russischen Kirche gegenüber dem „SMO“ unterscheidet sich kaum von der Position der säkularen Autoritäten.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Wir beobachten einen völligen Mangel an Sympathie und Empathie seitens der Führung der russisch-orthodoxen Kirche. Geht man von der Position und Rhetorik der russischen Kirche aus, so sind die gläubigen Ukrainer dieselbe Herde wie die gläubigen Russen. Doch in der Praxis ist davon nichts zu sehen. Bei Verletzten und Toten der Bevölkerung auf dem Territorium der Russischen Föderation (zum Beispiel in der Region Kursk) folgten stets Unterstützungsbekundungen von Patriarch Kirill. Gleichzeitig schweigt die ROK völlig, wenn die Ukrainer in ungleich größerem Ausmaß leiden.
Es ist auch unmöglich, die Synchronizität der Aktionen der Hierarchie der russischen Kirche mit der russischen Armee zu übersehen. Die von den russischen Streitkräften eroberten Gebiete werden nach kurzer Zeit der ROK angegliedert. Das heißt, die Russische Kirche trennt sie von der UOK und unterstellt sie ihrer Jurisdiktion, obwohl die Beschlüsse der Bischofssynode der russisch-orthodoxen Kirche von 1990 und die entsprechende Charta von Patriarch Alexius II. besagen, dass die UOK alle ihre Eparchien unabhängig verwaltet. Die russisch-orthodoxe Kirche appelliert weder an die Synode der UOK noch an den Metropolit Onufrij, sondern entlässt lediglich deren legitime Bischöfe aus den neu eroberten Eparchien und ernennt ihre eigenen.
Zwar stimmt es, dass all diese Prozesse in größerem Umfang nach dem 27. Mai 2022 offengelegt wurden. Ihre Voraussetzungen waren jedoch bereits mit Anbeginn der umfassenden Militäraktionen in der Ukraine erkennbar.
Als kirchliche und historische Voraussetzung für die Synode in Theophanija ist auch die Tatsache erwähnenswert, dass der Staat zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit groß angelegten Verfolgungen der UOK begonnen hatte. Im Gegenteil, die Behörden behaupteten, es sei während des Krieges unmöglich gewesen, die ukrainische Gesellschaft entlang religiöser Linien zu spalten, und diejenigen, die dies versuchten, würden im Auftrag der Russischen Föderation arbeiten. Allerdings gab es bereits vor 2022 Druck auf die Kirche, Versuche ihrer Verunglimpfung und Beschlagnahmungen von Kirchen, aber nicht im heutigen Ausmaß.
Die Ziele der Synode und seine Beschlüsse
Wir werden nicht näher auf den Verlauf der Synode selbst eingehen, sondern nur die Beschlüsse und deren Grundlage behandeln. Unserer Meinung nach verfolgte die Synode in Theophanija drei Ziele:
- Die Treue zur Lehre des Evangeliums zu wahren,
- Die Einheit der UOK zu bewahren und
- Sich von der russischen Kirche zu distanzieren, deren Handeln leider nicht mehr vollständig mit der Kirche übereinstimmt.
Die kanonischen Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche ermöglichten es vielen, die UOK als Teil jener Kirche zu betrachten und zu behaupten, sie unterstütze die russische Regierung im Krieg. Um dem Evangelium treu zu bleiben, war es daher notwendig, sich in jeder Hinsicht von der russisch-orthodoxen Kirche zu distanzieren und mit ihr, wie mit allen anderen Ortskirchen, nur die eucharistische Einheit zu wahren. Es war notwendig, die Position der russisch-orthodoxen Kirche klar zu widerlegen und dies in der Charta zu berücksichtigen.
Um dieses Ziel zu erreichen, fasste die Synode folgende Beschlüsse:
- „Die Synode verurteilt den Krieg als Verstoß gegen Gottes Gebot ,Du sollst nicht töten!‘ (Ex 20,13) und spricht allen, die im Krieg gelitten haben, sein Beileid aus.“
- „Die UOK äußert ihre Ablehnung der Position von Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland zum Krieg in der Ukraine.“
- „Die Synode verabschiedete die entsprechenden Ergänzungen und Änderungen der Charta über die Leitung der ukrainisch-orthodoxen Kirche und bekräftigte damit die vollständige Autonomie und Unabhängigkeit der ukrainisch-orthodoxen Kirche.“
- „Die Synode fasste Beschlüsse über die Erneuerung der Zubereitung des Hl. Myrrhons in der ukrainisch-orthodoxen Kirche.“
Letzterer Punkt ist eher vage formuliert, doch tatsächlich hat die UOK die Zubereitung des Hl. Myrrhons wieder aufgenommen, was ein Merkmal einiger (aber weitaus nicht aller) autokephaler Ortskirchen ist. Die Synode beschloss außerdem, ukrainischen Flüchtlingen im Ausland geistliche Begleitung zu bieten und dort UOK-Gemeinden zu eröffnen, was ebenfalls einer Ortskirche vorbehalten ist.
Mit diesen Entscheidungen distanzierte sich die UOK von der russisch-orthodoxen Kirche und brach alle administrativen Verbindungen zu ihr ab.
Vor Beginn der umfassenden Aggression der Russischen Föderation gab es in der UOK unterschiedliche Meinungen zur Frage ihrer kanonischen Struktur. Einige hielten die Erklärung der vollständigen Autokephalie für notwendig, während andere im Gegenteil engere Bindungen zur russisch-orthodoxen Kirche forderten. Der Status der Kirchenautonomie gefiel mehr oder weniger allen und ermöglichte die Wahrung der Einheit der UOK. Doch mit Kriegsbeginn geriet dieses Gleichgewicht ins Wanken. Seine Seligkeit Onufrij äußerte sich dazu wie folgt: „Bereits in den ersten Kriegswochen begannen zahlreiche Priester unserer Kirche, ihre Ablehnung der Worte und Taten von Patriarch Kirill zu bekunden. Sowohl einzelne Gemeinden als auch ganze Eparchien in verschiedenen Regionen der Ukraine weigerten sich, den Namen des Moskauer Patriarchen im Gottesdienst zu gedenken.“
In dieser Situation drohte der UOK eine weitere Verzögerung der Loslösung von der ROK ein unvermeidliches Schisma und eine katastrophale Destabilisierung der Kirchenführung. Darüber hinaus distanzierte sich Patriarch Kirill selbst von der UOK und den ukrainischen Gläubigen und unterwarf die ukrainischen Diözesen in den besetzten Gebieten. Die Argumente der ROK für solche Entscheidungen, die auf der militärischen Realität beruhen, erscheinen wenig überzeugend, da die Synode für Eparchien im Kampfgebiet einen separaten Beschluss fasste.
Einer der Beschlüsse der Synode in Theophanija lautete: „Während des Kriegsrechts, wenn die Verbindungen zwischen den Eparchien und der kirchlichen Leitung erschwert oder gar nicht vorhanden sind, hält es die Synode für angebracht, den eparchialen Bischöfen das Recht einzuräumen, in bestimmten Fragen des Diözesanlebens, die in die Zuständigkeit der Heiligen Synode oder des Primas der ukrainisch-orthodoxen Kirche fallen, unabhängig zu entscheiden und anschließend, sobald die Möglichkeit wiederhergestellt ist, die Hierarchie zu informieren.“
Dieser Beschluss gewährte den eparchialen Bischöfen in den eroberten Gebieten das Recht, die Eparchien unabhängig zu verwalten, ohne sich an Kiew wenden zu müssen, während sie weiterhin Teil der UOK blieben. Somit blieb die Verwaltung der Eparchien erhalten, und es bestand keine Notwendigkeit, sich hierfür an die ROK zu wenden.
Ein weiterer Beschluss der Synode – der Dialog mit der OKU – wurde gefasst. Die UOK gab die Bedingungen bekannt, unter denen ein solcher Dialog möglich sein sollte:
- die Frage der nichtkanonischen Ordinationen ihrer Hierarchen zu klären;
- die Abhängigkeit vom Patriarchat von Konstantinopel anzuerkennen;
- auf die Praxis der Kirchenbeschlagnahmung und anderer Gewalt zu verzichten.
Nur unter diesen Bedingungen wäre ein Dialog über die Vereinigung mit der OKU keine Abweichung vom Evangelium und den kirchlichen Kanones gewesen, doch die OKU weigerte sich, diese Bedingungen zu erfüllen.
Schlussfolgerungen
Zur Beantwortung der im Titel des Artikels gestellten Frage lässt sich Folgendes sagen: Die Synode der UOK in Theophanija ermöglichte der UOK, in der Kirche Christi zu bleiben, von der Lehre des Evangeliums nicht abzuweichen und nicht in ein Schisma einzugehen. Die Synode ermöglichte die Wahrung der Einheit der Kirche. Trotz der Verfolgungen ging nach der Synode kein einziger Bischof in die Struktur der OKU über. Die Zahl der Priester, die die UOK verließen, ist sehr gering, ebenso wie die Zahl der einfachen Gläubigen. Die UOK folgte nicht der Führung der Behörden und bewahrte ihre Kanonizität und die Reinheit des Glaubens. Dies ist in vielerlei Hinsicht das Verdienst der Synode der UOK in Theophanija.
Die Synode konnte die Verfolgung der UOK durch die Behörden nicht verhindern, doch darin liegt die Schuld bei den Behörden. Die einzige angebotene Möglichkeit, sie zu verhindern, war, sich selbst aufzulösen und sich in die OKU einzugliedern.
Drei Jahre sind seit der Synode vergangen. Dies genügt, um festzustellen, dass die absolute Mehrheit der UOK deren Beschlüsse akzeptiert und danach lebt. Keine einzige Ortskirche hat gegen die Beschlüsse der Synode protestiert oder erklärt, die UOK sei in ein Schisma geraten und habe aufgehört, eine Kirche der Gnade zu sein. Niemand hat die Gemeinschaft mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche abgebrochen; im Gegenteil, viele bekunden ihre Unterstützung und Solidarität. Die Beschlüsse der Synode wurden in der ganzen Orthodoxen Kirche anerkannt, und das ist das Kriterium ihrer kirchlichen Legitimität.