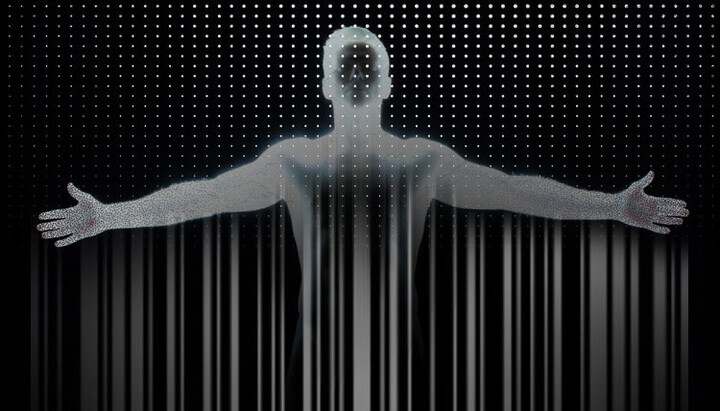Zorn und Stille: Mit welchem Gesicht wird uns Gott am Ende der Zeit begegnen?

Wir stehen vor zwei Abgründen: dem wilden Wirbelwind Michelangelos und dem sanften Blick des ehrwürdigen Andreas. Zwei Gesichter Christi – zwei Wahrheiten, die wir in den Feuern der Prüfungen erforschen werden.
Das Gewölbe der Sixtinischen Kapelle lastet schwer auf unseren Schultern. Die Geschichte versucht, uns auf den Boden zu drücken. Die Altarwand ist keine Malerei, sondern ein Schrei, der im Putz erstarrt ist.
Michelangelo (Buonarroti) kehrte ein Vierteljahrhundert nach der Bemalung der Decke hierher zurück. Aber die Welt hatte sich unwiedererkennbar verändert. Im Jahr 1527 erlebte Rom eine schreckliche Plünderung. Die Soldaten von Kaiser Karl V. verwandelten die Ewige Stadt in ein Schlachtfeld, die Kirchen in Ställe. Der Künstler malte „Das Jüngste Gericht“ in den Jahren 1536–1541. Dieser Schrecken des Weltuntergangs, den er auf den Straßen Roms gesehen hatte, blickte nun von der Altarwand auf die Betrachter herab.
Wenn sich die Muttergottes abwendet
Im Zentrum der Komposition steht Christus. Wir erkennen ihn nicht. Wo ist der sanfte Hirte, wo ist der, der sagte: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid“?
Vor uns steht ein athletischer Mann ohne Bart. Er ähnelt dem antiken Apollo. Seine Muskeln sind so angespannt, dass es scheint, als würde der Marmor jeden Moment zerbrechen. Seine rechte Hand ist nach oben gereckt. Diese Geste lässt den gesamten Raum der Freske erzittern. Er urteilt nicht – er versetzt dem Universum selbst einen Schlag.
Wir sind es gewohnt, die Gottesmutter in Szenen des Gerichts als Fürsprecherin zu sehen: Sie streckt ihre Hände zum Sohn aus und betet für die Sünder.

Hier duckt sie sich unter seiner Hand und wendet ihr Gesicht ab. Als würde sie sich geschlagen geben: Die Zeit der Gnade ist vorbei.
Es ist eine Geste der Kapitulation der Liebe vor der Gerechtigkeit. Sie macht mehr Angst als die ganze Hölle, die sich unten ausbreitet.
Der Zeremonienmeister des Papstes, Biagio da Cesena, bezeichnete das Fresko als unanständig. Zu viele nackte Körper. Es passe besser in ein Bordell als in eine Kapelle. Michelangelo rächte sich auf künstlerische Weise: Er stellte den Kritiker als höllischen Richter Minos mit Eselsohren dar. Als Biagio sich beim Papst beschwerte, antwortete dieser, dass seine Gerichtsbarkeit sich nicht auf die Hölle erstrecke.
Die Haut, die an einem Tag gemalt wurde
Zu Füßen Christi sitzt der Heilige Bartholomäus. In seinen Händen hält er seine abgezogene Haut, das Symbol seines Martyriums. Schauen Sie sich das Gesicht an, das auf dieser leeren Hülle zu sehen ist.
Es ist das von Leiden verzerrte Gesicht Michelangelos selbst.
Die Restauratoren der Kapelle erzählten, dass der Künstler diesen Teil an einem einzigen Tag gemalt habe. Ohne Karton, ohne Vorzeichnung. Mit halbtransparenter Farbe und breiten Pinselstrichen. Ganz untypisch für seinen Stil.
Sie sagten: Man hat das Gefühl, dass er dieses Bild so schnell wie möglich „fertigstellen” wollte. Als könne er es nicht ertragen, sein eigenes Gesicht zu sehen, das zu einer leeren Hülle geworden war.

Der Künstler versetzte sich selbst in einen seltsamen Raum zwischen Leben und Tod. Nicht unter den geretteten Gerechten. Nicht unter den verdammten Sündern. Sondern zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
In seinen Sonetten schrieb er über die Sehnsucht nach göttlicher Liebe. Über diejenige, die „am Kreuz ihre Arme ausbreitete, um uns zu empfangen“. Aber an der Wand der Kapelle stellte er Christus mit erhobener Hand dar, bereit zum Schlag.
Dieser Widerspruch ist kein Fehler. Es ist die Ehrlichkeit eines Menschen, der gleichzeitig an Gnade glaubt und den Zorn fürchtet. Der sich nach Umarmungen sehnt und Strafe erwartet.
Das westliche Konzept des „Dies Irae“ – des Tages des Zorns – hat hier seinen Höhepunkt erreicht. Das Gericht wird als juristischer Triumph des Gesetzes über die Sünde verstanden. Als Vergeltung Gottes, der durch menschlichen Verrat verletzt wurde.
Das Licht, das nicht richtet
Begeben wir uns nun tausend Kilometer weiter nach Osten und hundertzwanzig Jahre zurück in die Vergangenheit.
Im Jahr 1918 fand der Restaurator Grigori Tschirikow in einem Holzschuppen drei verdunkelte Bretter. In der Nähe der Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Zwenigorod. Als er begann, eine davon zu reinigen, kamen unter dem Ruß Augen zum Vorschein.
Die Menschen, die das Bild zum ersten Mal sahen, erstarrten. Denn diese Augen blickten nicht wie ein Richter auf einen Angeklagten. Sondern wie ein Vater auf seinen lange verlorenen Sohn.
Die Ikone ist schlecht erhalten. Die Farbschicht ist nur noch auf dem Gesicht und einem Teil der Schultern erhalten. Aber genau das erzeugt einen beeindruckenden Effekt. Als käme Christus nicht aus der historischen Vergangenheit zu uns, sondern aus der Ewigkeit selbst. Aus jenem goldenen Nichts, das vor der Erschaffung der Welt war.

Der heilige Andrej (Rubljow) malte den Zwenigorod-Erlöser zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit blühte in Russland die Hesychasmus-Bewegung. Die Mönche lernten, das Licht vom Tabor zu sehen. Dasselbe Licht, das auf dem Berg der Verklärung erstrahlte.
Dieses Licht durchdringt jeden Millimeter der Ikone. Der Blick des Erlösers ist keine Befragung. Es ist eine Begegnung. Und darin gibt es keinen Schatten des Zorns, der auf Michelangelos Fresko zu sehen ist. Die alten Väter nannten diesen Zustand „Zornlosigkeit”. Nicht Gleichgültigkeit. Sondern mit einer Liebe, die so tief ist, dass in ihr kein Platz für Zorn ist.
Pawel Florenski sagte über Rubljows „Dreifaltigkeit“: „Sie ist da, also ist Gott da.“ Diese Worte kann man wiederholen, wenn man den Erlöser von Zwenigorod betrachtet.
Das ist kein logischer Beweis für die Existenz Gottes. Es ist die Manifestation seiner Gegenwart durch Schönheit und Stille.
Das kostbare Azurblau (auf Russisch: Golubets) der Gewänder Christi: Es ist nicht nur Farbe aus einem teuren Mineral. Es ist die Farbe des Himmels, der nicht mehr unerreichbar ist. Der sich zur Erde geneigt hat, damit der Mensch ihn mit der Hand erreichen kann.
Die Tragödie der Liebe gegen den Triumph des Gesetzes
Nikolai Berdjajew formulierte den Unterschied in einem Satz: „Im westlichen Jüngsten Gericht – der Triumph des Gesetzes und der Gerechtigkeit. Im östlichen Antlitz – die Tragödie der Liebe”.
Für Michelangelo ist das Gericht ein Tribunal. Jede Sünde wird mit mathematischer Genauigkeit auf einer Waage abgewogen. Die Schuld wird festgestellt und bestraft. Gott tritt als oberster Ankläger auf, der Vergeltung fordert.
Für den heiligen Andrej (Rubljow) ist die Parusie (Wiederkunft Christi) eine Begegnung mit dem Licht. Die Qual der Sünder besteht nicht darin, dass sie ins Feuer geworfen werden, sondern darin, dass sie dieses Licht selbst nicht ertragen können, weil ihre Dunkelheit in seiner Gegenwart offenbart wird.
Wir fürchten nicht die Strafe. Wir fürchten uns davor, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind. Darin liegt der wahre Sinn des Gerichts als Selbstoffenbarung.
Der Filmregisseur Andrej Tarkowski schrieb im Drehbuch zu seinem Film über Rubljow: „Schau ihn an, er richtet nicht, er hat Mitleid ... In ihm liegt der ganze Schmerz der Welt und ihre ganze Hoffnung.“ Diese Worte fassen das Wesen der östlichen Ikonografie treffend zusammen. Christus, der Richter, ist nicht durch unseren Verrat verletzt, sondern durch seine Liebe zu uns. Er leidet mehr unter unserem Leiden als wir selbst.
Was wir jetzt wählen
Wir leben in einer Zeit, in der die Welt wieder instabil und blutig erscheint. Wie Rom nach der Plünderung von 1527. Gerechtigkeit scheint die einzige Rettung vor dem Chaos zu sein. Es fällt uns sehr leicht, Michelangelo zu verstehen, der sein Fresko in Erwartung des Endes der Geschichte malte.
Aber gerade jetzt brauchen wir den Erlöser von Zwenigorod. Nicht als Trost. Sondern als Erinnerung daran, dass hinter all dem Zorn der Geschichte ein stilles Licht steht, das niemals erlischt.
Wir stehen vor diesen beiden Bildern. Vor dem Wirbelwind der Sixtinischen Kapelle und vor der Stille der Zwenigorod-Ikone. Und wir verstehen, dass die Wahl zwischen ihnen nicht im Moment des Todes getroffen wird, sondern jetzt. Jeden Tag, wenn wir auf die Welt schauen, auf unsere Feinde, auf uns selbst im Spiegel unseres Gewissens.
Als Papst Paul III. Michelangelos Fresko sah, fiel er auf die Knie. Ob aus Entsetzen oder aus Begeisterung – niemand weiß es. Aber diese Geste sagt das Wesentliche aus: Angesichts der Ewigkeit fallen wir alle auf die Knie.
Welchem Blick hoffen wir am Ende der Zeit zu begegnen? Die strafende Hand des Titanen oder die sanften Augen der Zvenigorod-Lazur?
Diese Frage lässt sich nicht mit theologischen Abhandlungen beantworten. Sondern damit, mit welchen Augen wir selbst gelernt haben zu sehen. Denn letztendlich sieht uns der Richter mit unseren eigenen Augen. Gereinigt von Eitelkeit, Angst und Hass.