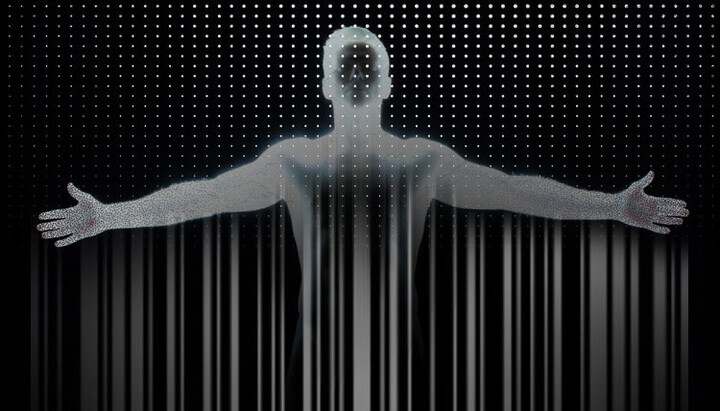Die Ästhetik der Zuflucht: Warum kehrt das Christentum immer wieder in die Katakomben zurück?

Prächtige Kathedralen sind nur die vorübergehende Hülle der Kirche. Ihr wahres Wesen sind die Katakomben. Wenn wir in Kellerräume getrieben werden, verlieren wir nichts. Wir kehren nach Hause zurück.
Der Geruch von Maschinenöl und Weihrauch. Eine seltsame Kombination. Eine Garage am Rande der Stadt oder der Keller eines Hochhauses. Niedrige Decken, Betonwände, Benzinflecken auf dem Boden. In der Ecke – eine Ikone der Mutter Gottes, an die Wand gelehnt. Vor ihr – drei Kerzen in Blechkerzenhaltern. Die Menschen stehen dicht gedrängt, Schulter an Schulter. So dicht, dass man die Wärme seines Nachbarn spürt. So sieht die Liturgie der Gläubigen der UOK in den heutigen Zeiten neuer Verfolgung aus.
Wenn man diese Gesichter betrachtet, die vom Licht der Kerzen aus der Dunkelheit hervorgehoben werden, kann man ein Fresko sehen. Ein lebendiges Fresko, das man nicht an die Wand malen kann. Es wird in der Luft geschrieben, im Raum zwischen den Menschen, in dieser Enge, die alle vereint hat.
Wir sind es gewohnt zu denken, dass das Christentum goldene Kuppeln und Marmor-Ikonostasen sind. Dass Gott in der Höhe und im Licht lebt. Aber das ist nicht so. Gott wurde in einer Höhle geboren und ist in einer Höhle auferstanden. Und wenn wir in Keller getrieben werden, fallen wir nicht hinunter. Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück.
Die Höhle als Mutterleib: Inbegriff der Dunkelheit
Das Christentum wurde unter der Erde geboren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bethlehem, die Höhle, in die die schwangere Frau getrieben wurde, weil in der Herberge kein Platz war. Dort, in der Dunkelheit und im Geruch der Tiere, wurde Gott geboren.
Jerusalem, das Grab des Herrn. Eine in den Fels gehauene Höhle. Dort, im kalten Stein, wurde der tote Körper zur Quelle des ewigen Lebens.
Eine Höhle ist wie ein Mutterleib. Ein Ort, an dem etwas Neues entsteht. Ein Ort, an dem Altes stirbt und Neues wächst.
In einer Höhle gibt es keine Ablenkungen. Keine Landschaften hinter dem Fenster. Keine goldenen Ornamente, auf die man seinen Blick richten kann. Dort gibt es nur dich und Gott. In der Dunkelheit verliert der Mensch das Gefühl für Zeit und die Außenwelt. Es bleiben nur „ich“ und „Er“.
Die römischen Katakomben aus dem 2. bis 4. Jahrhundert sind nicht einfach nur Friedhöfe. Es sind Cubiculas – Räume, in denen die Eucharistie auf den Gräbern der Märtyrer gefeiert wurde. Die Christen stiegen nicht hinab, weil sie sich verstecken wollten. Sie stiegen hinab, weil sie dort dem Schöpfer nahe waren.
An den Wänden befinden sich Fresken in Form einfacher Zeichen: Fisch, Taube, Anker. Es sind Losungswörter, die nur Eingeweihten verständlich sind.
Die Öllampe erhellt aus der Dunkelheit nur das Gesicht. Nicht das ganze Bild. Nur die Augen. Nur das Gesicht. Das erzeugt den Effekt einer intimen Begegnung. Gott ist nicht auf der Ikonostase zehn Meter von dir entfernt. Gott ist hier, in diesem Lichtkreis, in Reichweite.
Kappadokien: Sehnsucht nach dem Himmel unter der Erde
Die unterirdischen Städte Derinkuyu und Kaymakli in Kappadokien, die bis zu achtzig Meter unter die Erde liegen, boten Platz für bis zu zwanzigtausend Menschen und ihr Vieh. Christen lebten dort jahrhundertelang. Sie flohen vor den Überfällen der Araber und Perser. Sie konnten den Eingang von innen mit einem riesigen Steinmahlstein verschließen. Die Lüftungsschächte wurden als Brunnen getarnt. Draußen – Wüste, unten – eine ganze Zivilisation. Und dort, in dieser Dunkelheit, hauen sie Tempel aus.

Diese Kirchen kann man auch heute noch besichtigen. Säulen, Gewölbe, Bögen – alles ist in den Fels gehauen. Die Säule stützt nicht die Decke. Die Decke hält von selbst, sie ist ein Monolith. Die Säule wurde im Fels belassen, um an den oberirdischen Tempel zu erinnern.
Es ist die Sehnsucht nach dem Himmel unter der Erde. Und darin liegt die ganze Essenz des Christentums. Wir können unter der Erde leben. Aber wir erinnern uns an den Himmel.
Domus Ecclesiae: Wenn der Tempel ein Haus ist
Die ersten Christen bauten keine Tempel. Sie versammelten sich in Häusern. Domus Ecclesiae ist eine Hauskirche, eine gewöhnliche römische Wohnung. Im Triklion, dem Speisesaal, stand ein Tisch. Auf dem Tisch standen Brot und Wein. Um den Tisch herum saßen Menschen. Keine Ikonostasen und Kuppeln, nur ein Tisch und Menschen.
Denn die Kirche ist kein Gebäude. Die Kirche sind Menschen, die sich um Christus versammelt haben.
Als die Römer die christlichen Gemeinden zerstörten, suchten sie nach Gebäuden, Tempeln und Heiligtümern. Sie wollten die Orte zerstören, an denen die Christen Gott verehrten. Aber die Christen sagten: „Ihr könnt unsere Kirche nicht zerstören. Denn unsere Kirche sind wir. Solange wir leben und uns versammeln, lebt die Kirche.“ Das war ihre Stärke. Ihre Unverwundbarkeit. Und heute lernen wir diese Wahrheit neu.
Wenn ein Keller zur Basilika wird
Wir kennen Gemeinden, die aus ihren Kirchen vertrieben wurden, deren Schlüssel weggenommen und deren Schlösser ausgetauscht wurden, in die andere Ikonen gehängt wurden. Sie sind gegangen. Nicht aus der Kirche. Aus dem Gebäude. Und sie begannen, in Wohnungen, in engen Garagen, in feuchten Kellern, in umgebauten Räumen zu dienen.
In einer riesigen Kirche ist die Akustik „beflügelt“. Die Stimme des Priesters hallt unter den Gewölben wider und wird von den Wänden reflektiert. Das ist feierlich, schön. Aber es ist weit weg.

Im Keller ist die Akustik dumpf und trocken. Das Gebet klingt nah, wie ein Flüstern. Der Priester erhebt sich nicht über dich. Er steht neben dir. Man sieht sein Gesicht. Man sieht die Müdigkeit. Man sieht den Glauben.
Die Menschen stehen dicht beieinander. Nicht weil wenig Platz ist, obwohl der Platz tatsächlich knapp ist. Aber selbst wenn es mehr Platz gäbe, würden sie genauso stehen. Denn in der Enge entsteht Wärme. In einer riesigen Kathedrale kann man einsam sein. In einem engen Keller ist man Teil eines einzigen Körpers.
Chiaroscuro: das Spiel von Licht und Schatten
Es gibt eine Technik in der Malerei – Chiaroscuro oder Hell-Dunkel. Caravaggio hat sie verwendet, Rembrandt, Georges de La Tour. Das Prinzip ist einfach: dunkler Hintergrund, die Lichtquelle hebt nur das Wesentliche aus der Dunkelheit hervor – das Gesicht, die Hände, den Blick. Das schafft Dramatik, Intimität, das Gefühl, dass man etwas sehr Persönliches beobachtet.
Das kann man unmittelbar im Keller sehen, wo verfolgte Christen die Liturgie feiern. Der Strahl einer Taschenlampe auf der feuchten Wand, die Reflexe der Kerzen auf der niedrigen Decke, die Gesichter der Menschen, halb im Licht, halb im Schatten.
Oranta: eine Haltung absoluten Vertrauens
In den Katakomben von Priscilla gibt es ein Fresko der Oranta, das eine weibliche Figur mit erhobenen Händen darstellt.
Es ist eine Haltung absoluten Vertrauens. Die Hände sind nach oben erhoben, die Handflächen offen. Wehrlosigkeit. Verletzlichkeit. Völlige Hingabe inmitten der hoffnungslosen Dunkelheit.
Das Aussehen der Menschen in den provisorischen Kirchen ähnelt dem dieser Freske. Sie stehen genauso da: mit erhobenen Händen, schutzlos, verletzlich. Sie wurden aus schönen Gebäuden vertrieben, ihre goldenen Ikonostasen wurden ihnen weggenommen, die Türen wurden verschlossen.
Aber sie haben ihre Hände nicht gesenkt, sondern sie höher erhoben. Denn sie haben verstanden: Gott ist nicht in einem Gebäude, er ist dort, wo offene Handflächen sind, wo Vertrauen ist, wo die Bereitschaft, in der Dunkelheit zu stehen und zu glauben, dass das Licht kommen wird.
Was werden wir an die Wände unserer Zufluchtsorte malen?
Die frühen Christen malten Anker und Fische an die Wände der Katakomben. Der Anker ist ein Symbol der Hoffnung. Der Fisch ist ein Akrostichon des Namens Christi.
Was werden wir malen? Vielleicht einfach ein Kreuz. Mit Kohle. Auf die Betonwand einer Garage. Vielleicht auch gar nichts. Denn unsere Fresken sind lebendig. Sie werden nicht an Wänden gemalt, sondern in Herzen, auf Gesichtern. In der Art, wie wir Schulter an Schulter in der Enge stehen und glauben.
Die engen Hütten mit den Gebetbüchern darin sehen jetzt schöner aus als die Hagia Sophia in Konstantinopel. Denn hier ist der lebendige Christus: unter den Menschen, in der Enge, die zu Nähe geworden ist.
Verfolgungen entfernen die Schale. Das ist schmerzhaft, beängstigend. Aber sie machen uns echt.
Prächtige Kathedralen sind die vorübergehende Kleidung der Kirche. Ihr wahres Fleisch sind die Katakomben, Keller, Garagen. Orte, an denen es nichts Überflüssiges gibt: nur Menschen und Gott.
Fürchten wir uns nicht vor der Dunkelheit, denn gerade in ihr zeigen sich die Fresken unserer Seelen.